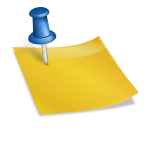Nach Mitternacht, wenn die Zeit stillzustehen scheint, stöbert man oft noch über interessante Onlineaufsätze und stößt so auch auf die Süddeutsche Zeitung. Nein, hier wird nicht getwittert, hier lebt der Essay noch und mit ihm ein Stück Lebenskultur. Google wird von der profanen Suchmaschine da zum Zauberspiegel und darüber gerät man dann selbst ins Sinnieren und auch ins Staunen, wenn Menschen mit ihren Worten Perspektiven eröffnen, die man im Trubel sonst nicht gefunden oder zumindest übersehen hätte.
Es bleibt dabei, dass Äpfel keine Birnen sind und erst recht kein Gemüse und es daher müßig ist, sich darüber zu streiten, was denn besser sei und ob nicht das eine (Texte) bald dem anderen (Videos) unterläge oder gar untergeht. Sicher, man kann es ermessen, indem man die Größe der Früchte abmisst oder die Anzahl ihrer Liebhaber abzählt, doch an den wirklich existenziellen Wahrheiten, die hinter allen Dingen stehen, ändert dies nichts: Es gibt nur die eine Welt um uns herum, egal, womit man sie betrachtet und solange man die Dinge an der Welt misst und nicht die eigentliche Welt mit ihren vielfältigen Abbildungen verwechselt, den Medien, hat jedes einzelne Medium seine Vor- und Nachteile.
Der Artikel „Der seltsame Fall des Benjamin Google“ von Christian Kortmann beschäftigt sich anhand von Google und Youtube-Videos essayistisch mit dem Phänomen der Selbstvergewisserung und dem Wandel der Zeit, dem eigenen auch vor allem. Was spiegelt uns eine Suchmaschine? Die Welt oder ihre Abbildung? – Die Abbildung unserer eigenen Sehnsüchte, nicht mehr und nicht weniger, meint Kortmann und legt uns abschließend ein echtes Fenster zur Welt nahe, aus dem man eher schauen sollte als in die Mattscheibe, oder doch zumindest zu gleichen Teilen, womit er zwar recht hat, aber – hier beißt sich die Katze in den Schwanz – wieder einmal mehr auf ebendiesen Bilderschirm zurückgreifen muss, Googles Youtube diesmal, um uns dies zeigend vor Augen zu führen.
Trotz alledem: Ein leicht süßsaurer doch leserlicher Artikel mit Tiefgang. Hier wird betrachtet, reflektiert und verknüpft und das Ergebnis ist sicher mehr als die Summe seiner Teile. Denn es verbindet Dinge, die bislang nur für sich waren, hier aber ein neues Mosaik bilden, das weiterführt. Mögen alle Teile auch sonst recht banal sein und längst vorhanden, so liegt, wie in jedem guten Essay, die Kunst in der Verknüpfung und das Ergebnis ist polyphon und offen, nicht einfach multimediale Selbstverstärkung. Darum ist auch keines seiner Teile verzichtbar: Der Text ebensowenig wie die Videos, die er verbindet und – oft vergessen – die Gedanken und Gefühle des Betrachters, die beide auslösen.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man. Tatsächlich zeigt sich vieles von dem, worüber Kortmann in seinem Artikel augenzwinkernd sinniert in den Bildern, Videos, auf die er verlinkt, ja mehr noch: Fast unbewusst fügen wir unsere eigenen Erfahrungen hinzu. Und wir werden betroffen, wenn wir den verlinkten Noah um 6 Jahre altern sehen, von dort aus, youtubeintern verlinkt andere gar um vierzig oder auch nur, in rascher Bilderfolge, um einige Monate. Da findet man viele Videos, die Menschen zeigen, die sich teils unheimlich wandeln, allmählich aber unabänderlich anders werden, Menschen, die sich andererseits aber doch so handfest darum bemühen, im Kern sie selbst zu bleiben oder auch nur sich selbst gewiss zu werden.
So wichtig scheint es ihnen, dass sie die unheimliche Mühe auf sich nehmen, sich nicht nur über Tage und Wochen, sondern gar über Monate oder Jahre in der immer gleichen Pose abzufotografieren, täglich und nur, damit für den Zuschauer die Zeit in einem kurzen Videos rasend Revue passiert und der Betrachter über das Gesehene schaut und je nach seiner Stimmung und musikalischer Untermalung in positive oder melancholische Verzückung gerät. Wobei wohl immer ein gewisser Schauder über die Zeit und ihr Vergehen mitschwingt, so wie man auch besinnlich und nachdenklich wird, wenn man im Herbst die Blätter fallen sieht oder an einem frischen Grab vorbeigeht, auf dem doch Blumen blühen. Manchmal aber überwiegt auch das Staunen, wie vielfältig und immer wieder neu Lebewesen sind und eben auch Menschen.
Sicher machen uns diese Bilder, Videos betroffen. Sie haben, um ganz frei mit Roland Barthes zu sprechen, das gewisse Etwas, das uns trifft, betroffener macht, inniger angehen kann, als jedes Wort, das wir lesen oder hören. Doch alleine reflektieren können sie nicht, die bunten Bilder, verstehen, dass müssen wir schon selbst tun. Und können oder tun wir es nicht selbst, so brauchen wir Erfahrungen, die wir von anderen borgen können, in wohlüberlegten Worten, Texten vor allem. Dann lassen wir uns doch recht gerne auch mal ein Stück an der Hand nehmen.
Beides aber sinnvoll zu verknüpfen, Bildgefühle und Wortgedanken, um damit über sich selbst hinaus und auf die Welt zu weisen sollte das eigentliche Ziel moderner Medien sein. Eine sinnvolle Verknüpfung, die auch dem Leser und Betrachter noch genug Raum für eigene Gedanken lässt und ihm ermöglicht, sein eigenes Besinnen nicht zu vernachlässigen, wird der Wirklichkeit um uns und in uns selbst wohl am ehesten gerecht. Hier bietet das Internet gegenüber dem Fernsehen bedeutsame Vorteile, da die Bilderflut eigentlich jederzeit sinnvoll ergänzt werden kann, auch individuell, indem der Nutzer selbst eigenen Gedanken nachgeht. Dazu kann es aber auch nötig sein, Denkpausen zu machen, zu schweigen oder auch bloß zu sinnieren oder zu träumen.
Dies aber ist etwas, was die Medien nicht können, nur die Menschen selbst, was diese aber oft vergessen, vor allem in einem Medium, das sich zunehmend selbst für die Welt hält. Daher ist Kortmann wohl zuzustimmen: Der Fall des Benjamin Google ist auch der Fall derer, die in den Spiegel schauen, unser eigener. Und so wird im Internet vieles bewegt, besprochen und bebildert, viel gesucht und gehäuft, kreist letztlich aber nur um sich selbst und erschöpft sich damit, wenn ein einziges Fenster immer offen steht.