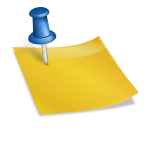Licht und Schatten, Linie und Punkt
Ein Schülerzeitungsessay
Teil 1: Keine Zeit, kein Spiel
Lange warte ich nun schon darauf, dass einmal wieder der Inhalt über der Masse, die Formkunst über der Geschwindigkeit steht. Doch wenn dies auch zeitweise schon näher schien, so bleibt dieses Ziel doch bislang in der Ferne. Warum ist es nicht möglich, dass wieder Ideen sprühen in Texten, dass Zeichnungen wieder originell sind und kunstfertig und dass die Hauptsache einer Redaktionsarbeit wieder in der Auseinandersetzung mit Inhalten besteht und nicht darin, dass überhaupt etwas zustande kommt? Dass viel mehr da ist, als publiziert werden kann? Mehrere Faktoren verhindern dies immer noch.
Zum Ersten gibt es schon länger keine Diskussionskultur mehr am Klettgau-Gymnasium. Wenn überhaupt überhaupt debattiert wird, dann werden lehrerseitig mühsam Formen festgelegt, eine Diskussion über Inhalte aber vermieden. Die Ursache dafür ist, anders als früher, eigentlich längst nicht mehr innerhalb der Lehrerschaft zu suchen – das war einmal – sondern darin, dass übergreifend falsches Konsensempfinden, wie es durch die achso neuen Medien, z. B. auch Foren vermittelt wird, die notwendige Dialektik qualitativer demokratischer Meinungsbildung aushebelt. Dialektik ist Veränderung, Weiterentwicklung einer Argumentation. Argumentiert wird schon lange nicht mehr mit sachlichen Argumenten, es werden nur vorgebliche Empfindungen in Waagschalen geworfen. Diese sind statisch, hochsubjektiv, bloß persönlich. Jeder darf seine Meinung haben, und dabei verbleibt es auch. Im Zweifelsfall entscheidet die Mehrheit. Nichts weiter. Jede Erörterung, die darüber hinausgeht, sei sprachlich-rhetorischer Firlefanz, Deutschlehrerhumbug. Insofern scheint es auch keineswegs verwunderlich, dass auch zur fundierten journalistischen Stellungnahme kaum jemand mehr bereit, ja überhaupt fähig wäre: Wenn die eigentlichen Inhalte eh egal sind und die persönliche Empfindung alles, dann braucht man auch nicht mehr darüber schreiben, denn was dabei herauskäme, wäre ohnehin nur ein graupapiernes, fades TV- oder Forengeplapper. Davon gibt es eigentlich schon genug. Und darum wird heute auch so wenig Erörterndes geschrieben und gelesen.
Zum Zweiten tilgt nach der inhaltlichen auch die künstlerische Dimension die schnöde digitale Falle. Ja doch, es gibt noch viele Schüler, die gut zeichnen können und sogar Ideen haben, doch diese meiden sehr bewusst den Computer, der Techniklaien entweder den Zugang ganz verwehrt, oder überproportional Lebenszeit stiehlt, damit davon irgendetwas digital ankommt. Jugendlichen Computerfreaks umgekehrt mangelt es zwar nicht an Lust und technischen Fähigkeiten, jedoch in aller Regel am künstlerischen Feingefühl. Computer produzieren vieles, doch die Ästhetik schulen sie sicher nicht. Eher leisten sie dem gefährlichen Missverständnis Vorschub, Kunst lasse sich auf einen Satz Layoutregeln reduzieren, die zudem noch lediglich modisch vorgegeben wären. Dass somit jegliche Formkunst ausfällt, Grafik zur bloßen Schablone verkommt, ist die traurige Konsequenz. Und für Schablonen ohne Inhalt und Aussage opfert ganz zu Recht niemand seine teure Lebenszeit. Es muss möglichst einfach und schnell gehen. Sonst erstirbt die Lust. Hat man überhaupt eine Knopfdruckgrafik erzeugt, ist man froh. Dass Grafiken, das Layout, ein Cover zudem etwa eine inhaltliche Haltung zeigen könnten – eine „Message“ – völlig undenkbar! Dazu sind Grafiken heutzutage viel zu austauschbar und zu kurzlebig. Und deshalb wird heute so wenig Künstlerisches gestaltet und betrachtet.
Dabei gäbe es so vieles, was genauer, ja was am Besten lange und intensiv zu betrachten wäre in einer Zeit, in welcher sich sämtliche Paradigmen augenscheinlich wandeln, einer Wandelzeit, in welcher manche altbackene Idee sich längst in eine schmerzhaften Sackgasse verläuft und in der immer klarer wird, dass man mutig neue Wege gehen müsste – oder zumindest einmal vordenkend Alternativen in Erwägung ziehen. Wie soll sich denn beispielsweise Ganztagesschule jugendkonform gestalten lassen, wenn terminierende Konferenzen und Ausschüsse der Erwachsenenseite alles sind und die andere Seite – die mindestens genauso stark betroffen ist – außer kurzatmigen Stellungnahmen (Motto: „Find ich doof.“, „Find ich geht so.“, „Habe keine Meinung.“) nicht einmal rohe Gedankenbrocken liefert.
Sich in abgeschlossenen Lästergrüppchen zu treffen mag eine recht gruschelige Anlegenheit zu sein. Doch es wird keine realexistierenden Probleme lösen und außerhalb der virtuellen Welt nichts bewirken – außer dass es vielleicht bei Manchem ein deprimierendes Gefühl der Hilflosigkeit erzeugt, eine dunkle nebulöse Stimmung, einen drauen Grauschleier, den viele, Schüler wie Lehrer, längst bemerken, den sich aber niemand erklären will. Und wenn es Erklärungen gibt, so hat man selbst damit doch nichts zu tun. Dabei ist die Welt eigentlich von sich aus keineswegs grau und niemals notwendig so, wie sie gerade ist.
Es gibt viele Möglichkeiten, die Gegenwart mit eigenen Gedanken zu gestalten. Nur müsste man es tun. Tun kann dies nicht nur sachlich-argumentierend – was ehrlich gesagt nicht nur eine sehr erwachsene, anstrengende, sondern sicher auch die langweiligste aller Methoden ist. Und ob sie überhaupt ausreichend wäre, sei dahingestellt. Denn es genügt nicht, überhaupt eine Meinung zu haben, es reicht auch nicht, irgendwelche guten Argumente zu einer Sache zu haben. Damit ist die Angelegenheit ja noch keineswegs real umgesetzt. Man muss sie auch weiterentwickeln und ausspielen können. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Wirklichkeit ist komplexer, als es dem Fachexperten lieb ist. Da geht nichts in vorgegebenen Schablonen, sondern es klappt in einem eher freien Spiel – so wie echte Kunst mit den Regeln spielt und daraus in kreativer Weise neue Ordnungen erzeugt, statt nur Paradigmen abzuklappern. Man kann natürlich auch einfach fremdbestimmt Regularien abhaken, mit oder ohne innere Kündigung ist dabei egal. Das ändert alles nichts an Problemen und Gegebenheiten. Die bleiben auch dann wie sie sind, wenn man damit persönlich einverstanden ist oder nicht. Ändern kann man die Wirklichkeit aber sehr annehm auf spielerische Weise. Nur müsste man dazu ein neues Spiel erfinden, anstatt alte Ideen bloß zu kopieren oder konsumistisch altbekannte Mantren zu wiederholen. Spiele dürfen zwar kopieren und wiederholen, aber Kopieren und Wiederholen an sich sind noch nicht Spiel. Spiel ist mehr.
Wahrscheinlich müsste man vielen erst wieder beibringen, was echtes Spielen überhaupt ist. Längst haben das viele aus ihrem Gedächtnis weggespart – und damit an der falschen Stelle gekürzt. Denn Spiele sind etwas Schönes – und Nützliches. Und eigentlich bleibt jung und alt auch keine andere Wahl, als wieder zu spielen. Vieles muss einfach ausprobiert werden, wenn Probleme keine vernünftige Lösung haben. Aber wie soll das gehen? Was ist denn ein echtes Spiel? Etwa ein schnödes Ratequiz? – Nein. Eine reine Körperbetätigung? – Auch nicht. Was dann? Schabloniertes Unterhaltungsgedaddel für Gambler? Eine zeitaufwendigere Lernmethode? Müßiggang und Laster?
Es ist doch mehr als traurig, dass trotz mehrerer Jahrhunderte fundierter Bildungstheorie das pädagogische und humanistische Element des Spiels praktisch noch immer geflissentlich ignoriert wird, gerade auch von denen, die es besser wissen sollten, den studierten Lehrkräften und den verantwortlichen Eltern. Und dass heute statt Spielen allerhöchstens Games ausgezockt werden – deren humanistische Dimension zumal oft sehr beschränkt ist oder man sie von Lehrerseite als reines Lernmittel zweckbindet – was dem Spiel als solchem eigentlich zuwiderläuft. Wo bleibt da die Freiheit, wo die Freude? Allerhöchsten kann ein solches „Spielchen“ spaßig wirken, oft aber ist es seinen Namen und damit auch seine Zeit nicht wert.
Ein Spiel ist da erst Spiel, wo es frei und freiwillig wird – und das ist da der Fall, wo der Mensch sich wirklich selbst einbringen kann. Ein solches Spiel ist nicht steinern an vorgefertigte Vorgaben gebunden. Ein solches Spiel dreht sich nicht im Kreis wie viele Forendiskussionen. Echtes Spiel ist da, wo neue Gedanken entstehen können, nicht dort, wo alte Vorurteile verfestigt werden. Ein echtes Spiel bestimmt seine eigenen Regeln – und zwar im Spiel selbst. Nicht alles ist erlaubt, erlaubt ist aber, was das Spiel schöner macht. Grenzen sind nur durch die Fantasie der Spieler vorgegeben. Folglich muss ein Nebenziel sein, diese zu erweitern.
Fantasie und Spiel – Das hat an der Schule aktuell viel zu wenig Platz! Warum eigentlich? Frei nach Schiller wird der Mensch erst dort wirklich Mensch, wo er spielt. Und Menschen zu bilden sollte doch eigentlich die Aufgabe der Schule sein, auch in Zeiten des G8. Und eine reine Zeitfrage ist das eigentlich auch nicht. Es ist eher eine Frage, wie wir mit unserer immer schon begrenzten Lebenszeit umgehen. Denn eine Eigenheit echter Spiele ist, dass sie ihre eigene Zeiten festsetzen, ja erzeugen. Das weiß jeder, der mal ein echtes Spiel gespielt hat. Ein echtes Spiel ist auch nicht vom Materialwert abhängig. Alles geht. Mit Texten, Geschichten, ja bloßen Worten oder Zeichen zu spielen scheint für manchen Zeitgenossen aber undenkbar geworden. Doch wäre es vielleicht genau das, was Not täte, um fruchtbare Kommunikation und damit Gemeinschaft überhaupt erst wieder zu ermöglichen: Mit Schule in Wort und Bild spielen. Und genau das sollten auch Schülerzeitungen leisten, dann gewinnen sie wieder Sinn und auch genug Kraft und Zeit.