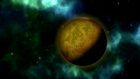s war an einem trüben Mittwochmorgen, als D. das Bääh zum ersten Mal auffiel. Das Vieh machte sich unflätig inmitten breit, drumherum die Meute. Es sah nicht sehr ansehnlich aus, etwas aufgedunsen, teils wie Hefeteig, teils einer Wasserleiche nicht unähnlich. Auch bei nüchterner Betrachtung hatte es sehr unvorteilhafte Proportionen. Es roch sehr streng, was aber bestimmt dadurch kompensiert wurde, dass es in einem Fort allerlei zerstreuende Geräusche von sich gab. Schüler, die drumherum standen, zeigten reges Interesse und Begeisterung an diesem animalischen Wesen. Nur an einigen von ihnen bemerkte D. zunächst noch eine Weile lang die Zurückhaltung und Skepsis, die auch ihm selbst zu eigen waren.
Zunächst versuchte D. es damit, den Umstand zu ignorieren, dass dieses Tier sich ständig und durchaus störend in unmittelbarer Nähe befand, jedoch wurde die Aufmerksamkeit der Schüler durch das Vieh unweigerlich abgelenkt, ja teils hatte D. sogar darüber hinaus das Gefühl, die jungen Scholaren ergötzten sich fortwährend an seinem animalischen Gehabe. Wie so oft gewann D. aber durch eine Mischung von Druck und Stoffdichte wieder die Oberhand. Erst später dann stellte sich dies nachträglich als Illusion heraus, ja sogar als irgendwie tragisch. Es sei Epidemien und schweren Unglücksfällen im Allgemeinen ja nicht vorher anzusehen, wie D. vor Zeugen beteuerte, mit welch blinder Intuition sie sich zur Katastrophe fügen und man selbst, gerade in moralischen Angelegenheiten, sei sich ja durchaus nicht bewusst, wie doch das Gute dem Verderbten nahe, selbst wenn es an der eigenen Gesinnung nichts zu zweifeln gebe. So ignoriert man oft unbewusst über längere Zeit mangelhafte Zustände, ja verschlimmert sie durch Gewöhnung nur noch, da man sich selbst für unzureichend oder nicht im Stande erachtet, Abhilfe zu schaffen. Ja, man warte oft und dulde, bis es gänzlich zu spät ist.
Es hätte ihn, wie er später zugab, unweigerlich an Lord Chandos erinnern müssen, doch schrieb D. die langsam und schleichend einkehrende, ihm aber doch erst viel später plötzlich auffallende Ruhe unter den jugendlichen Zuhörern einer ihm neu zugedachten Aufmerksamkeit zu. Freilich, das Schmatzen und unsaubere Röcheln des Viehs war weiterhin hörbar – das Ungetüm stand ja mitten im Raum – doch die Schüler schwiegen, sprachen nur selten und kurz noch miteinander und schienen auch dann eher peinlich berührt zu sein, selbst wenn man sie nicht zuvor mit strengen Blicken ermahnt hatte. Forderte man sie zum Reden auf, so artikulierten sie sehr langsam und mit Bedacht, als wöge jeder Begriff schwer und müsse mit großer Überlegung genutzt und ausgesprochen werden. “Eine Sache, die uns Lehrern ja nicht unlieb ist.” – konstatierte später auch der Direktor zu seiner Verteidigung. Doch hätte es D., wie er selber eingestand, zu denken geben müssen, dass die Wörter teils wie unter Schmerzen oder im Rausch von sich gegeben wurden und dass, so huldvoll auch manches gesagt wurde, der Sinn sich immer mehr der Oberfläche und der Beschreibung der einfachsten Sachverhalte näherte.
Zuerst und unmerklich schwanden die Metaphern. D. war es freilich nicht ganz neu, dass sich vielen jungen Menschen die Tiefendimensionen der klassischen Literatur nicht von sich aus erschließen – wozu gibt es sonst Literaturunterricht – doch was D. – und hier war er ungefehlt, da dies seine Generation ja nicht mehr war – was er nicht bemerken konnte, war, dass auch die eigenen Sinnübertragungen, welche die jugendlichen Scholaren untereinander, oft im Scherz und Spott oder zur Mystifizierung ihrer eigenen Lebenswelt verwenden, versickerten, zerfielen und hinschwanden wie auch der Rest ihrer Konversation, die sich zunehmend zu einzelnen, impulsartigen Ausrufen verjüngte. Dies, vermutet D. heute, musste bereits lange vor dem unmerklichen Verstummen im Unterricht eingesetzt haben und womöglich hätte man es aus den ratlosen Blicken erschließen können, welche die Schüler in dieser Phase einander oft noch zuwarfen. Mit der Zeit aber gewöhne man sich an vieles und so konnte D. letztlich nicht mehr ausmachen, wann auch diese gemeinschaftssuchenden Blicke erstarben.
Nicht selten übermüden Jugendliche sich durch unachtsame Freizeitgestaltung, sodass D. die Trübung ihres Blickes zunächst nicht in den Sinn kam. Doch fiel ihm bei routinemäßigen Heftkontrollen gehäuft auf, dass die Tafelabschriebe unklarer wurden – und das, obwohl die Machart und Ausfertigung der Arbeiten auf eine gewisse Mühe und Anstrengung schließen ließen. Bisweilen hatte D. aber das unzweifelhafte Gefühl, als ob hier jemand versuchte, Dinge wie mit Gewalt zu replizieren statt einfach abzuschreiben, ja als ob die Worte nur mehr auf das Papier aufgemalt würden, ohne dass ein weiterer Sinn dahinter zu vermuten sei. Und auch hier kam nach einer Weile erschwerend hinzu, dass die Formen zunehmend ungelenker, ja plumper wurden, was teils dadurch kaschiert wurde, dass manchen Hausarbeiten ablenkende und obszöne Zeichnungen beigefügt wurden, die erahnen ließen, dass die Schüler dem Vieh mehr und mehr an Aufmerksamkeit zukommen ließen.
Doch war es keine Aufmerksamkeit, wie man sie einer Person oder Sache entgegenbringt, der man sich aufrichtig nähern möchte. Auch die grafischen Versuchungen schienen eher so gehalten, als sei eine unerklärliche Zerstreuung über deren Urheber gekommen, der sie sich nicht mehr weiter zu erwehren wüssten, als dass sie von den eigentlichen Aufgaben dazu übergingen, animalische Formen nachzuzeichnen, die über die Tage und Wochen aber auch zunehmend in nurmehr unverständliche und unzusammenhängende Kritzeleien zerfielen. Ja, die Jugendlichen wurden fataler und letztlich passiv.
D.s Versuche, die Schüler durch Strenge und Ordnungsmaßnahmen auf das alte Niveau zurückzuheben, scheiterten. Zunächst zeigte es durchaus eine Wirkung, als D. durch strikte Punktabzüge – gerade auch in Klausuren – Absonderlichkeiten und Schlampereien im Schriftlichen, wie auch das zunehmende Schweigen – und in einigen Fällen hinzukommendes Röcheln und Schmatzen – bestrafte. Zuerst noch schluchzten die Scholaren auf, später zogen sie aber nur noch Taschenrechner aus ihren zunehmend verwahrlosten Taschen und stöcherten eine Weile auf deren Tasten herum wie Krähen in einem Misthaufen, bis sie dann völlig verstört aufblickten, als hätten sie vergessen, was sie gerade überhaupt zu tun gewillt gewesen waren. In der letzten Phase, kurz bevor D. dann die Schuldirektion einschaltete, reagierten sie kaum noch auf seine Ermahnungen und Zurufe, so, als verstünden sie den Sinn seiner Worte nicht mehr.
Es mag daran gelegen haben, dass die jede Ästhetik mutwillig mit Füßen – oder besser gesagt – Pfoten – tretende Erscheinung des Bäähs, dieses übergroßen Viehs, das es sich im Raum zwischen D. und den Schülern inzwischen nestartig eingerichtet hatte, immer noch einen Großteil auch seiner Aufmerksamkeit durch ein schwehlendes Gefühl von Ekel und Übelkeit absorbierte. So fiel ihm erst spät auf, dass sich auch in der Schülerschaft eine gewisse Unförmigkeit breit machte. Zuerst erschienen D. die Schüler nur auffällig müde und gebeugt, aber in den Pausen erkannte er zunehmend ihre verkrümmte Körperhaltung. Auch dass in gewissen Lebensphasen die Extremitäten zu ungleichmäßigem Wachstum neigen verschleierte D. über lange Zeit die Tatsache, dass auch Hände und Füße mancher Unterrichtsbesucher teils auf die Größe von Pranken angeschwollen waren. Insgesamt war die fleischliche Hülle der meisten angewachsen, doch D. erklärte sich das lange damit, dass sowohl spätpubertäres Wachstum wie auch die vorweihnachtliche Nasch- und Lebkuchenzeit bei jüngeren Menschen nicht ganz ohne Spuren zu hinterlassen vorbeigegangen war, zumal, wenn wie in letzter Zeit an den Wochenenden noch ausgiebige Freudenfeste hinzu gekommen waren. Es stimmte D. allerdings schon etwas eigentümlich, als einige Schüler begannen, im Unterricht ihre Schuhe auszuziehen oder mit Scheren und Zirkeln – oder in einem Fall sogar Zähnen – Löcher in sie hineinzunagen, aus denen später dann wabbelige, unförmige Zehen mit feisten Nägeln hervorlugten. Viele gingen auch dazu über, im Unterricht nur lose, weit dehnbare Sportanzüge zu tragen, aus es denen dann an allen möglichen Stellen, besonders um den Rumpf herum, wie Fett hervorschwabbelte. Ja manchmal glaubte D. im Augenwinkel fast so etwas wie Ansätze von Fellbüscheln zu erhaschen. Womöglich ließ bei einigen aber auch einfach die allgemeine Körperpflege nach. Denn der inzwischen sehr strenge Geruch konnte im Raum konnte wohl nicht mehr nur von dem Vieh herstammen. D. schrieb in jener Woche noch einen, kurzen, gutmütigen aber auch mahnenden Brief an die Verwaltungsbehörde über diese Zustände, der jedoch unbeantwortet blieb.
Am vorletzten Tag bemerkte D. etwas, das er für den Anflug einer nahenden Grippe hielt: Dass einigen Schülern so etwas wie grüner Schleim aus Nase und Mund lief, während D. für sie mit großer Geduld und Mühe an die Tafel schrieb und den Klassenprimus noch dazu bewegen konnte, grob die ersten drei Vokale – A – E – I zu artikulieren, was aufgrund des lauten Schniefens und Schnaubens aber kaum noch herauszuhören war. Da wurde D. mit einem Schlag klar, was sich an diesem Tag geändert hatte: Das Bääh inmitten des Raumes war verschwunden, nur eine leichte Delle im fast vollends vermüllten Raum ließ Wissende noch auf sein ehemaliges Vorhandensein schließen.
Tags darauf waren keine Schüler mehr vorhanden.