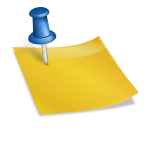Es war zunächst Sabbat, spät nachmittags schon, der Tag vor dem Palmsonntag und mindestens der dritte, nachdem jene furchtbare Erkältung über ihn gekommen war, da beschloss D., dennoch endlich einen deutlichen Fortschritt in seinem Leben zu wagen, also wieder einmal einen bewusst frühlingshaften Spaziergang anzutreten. Da er nicht alleine in die inzwischen vielleicht zaghaft angegrünte, leider aber doch weiterhin reichlich feucht verregnete Natur hinausschreiten wollte, begab er sich zu seinem imaginären Lieblingssofa, worauf seine charmante imaginäre Freundin gerade ahndungsvoll einen weiteren imaginären Wollschal in meistenteils undefinierbaren Farben strickte, und D. erkundigte sich höflich, ob sie ihm denn beim Lustwandeln im imaginären Frühlingswetter nicht Gesellschaft leisten mochte. Er bekam, wie allerdings schon zu erwarten gewesen war, keine Antwort.
Also begnügte sich D. damit, stattdessen seinen lieben imaginären Hund auf die kleine, arglose Wanderung mitzunehmen. Der imaginäre Hund antwortete zwar nicht, war von D. aber auch gar nicht extra darüber befragt worden und wurde einfach zwangsrekrutiert. Ihn auf seinen mehr ziellosen als planungsvollen Spaziergängen zu begleiten war ohnehin der eigentliche Hauptlebenszweck des imaginären Hundes. – Da D. Hunde aber im Allgemeinen überhaupt nicht besonders mochte, hatte es recht lange gedauert, bis er sich dann doch für genau ihn entschieden hatte, weil er über die meisten Eigenschaften, die D. an Hunden für gewöhnlich verabscheute, nicht erst verfügte, und mehr noch, auch einige sehr positive Merkmale aufwies: Der imaginäre Hund war, wie für gewöhnlich die meisten imaginären Haustiere, von eher blässlicher Färbung, also ziemlich durchschaubar, darüber hinaus ausgesprochen folgsam, sehr still, kostensparend und äußerst genügsam. Letzteres war besonders wichtig auch deshalb, da D. aufgrund seiner schwer voraussehbaren Arbeitszeiten oft spät oder teils gar nicht mehr abends zurückkam, somit den Hund kaum selbst regelmäßig füttern oder pflegen konnte und weil in dieser Sache auf D.s imaginäre Freundin auch kein Verlass war.
Es war nun zwar sicherlich nicht so, dass D.s imaginäre Freundin mit seinem treuen tierischen Gefährten etwa nicht auskam, oder dass sie ihn gar innerlich ablehnte, aber obwohl sie sich selbst nie laut bei D. darüber beschwerte, geschweige denn in den abendlichen Zwiegesprächen etwa entsprechende Defizite offen zugab, so hatte D. doch oft das Gefühl, dass sie jegliche Hausarbeiten, wahrscheinlich aus feministischen Erwägungen heraus, prinzipiell ablehnte, um nicht gar zu sagen: boykottierte. D., der sich übrigens selbst für einen aufgeklärten und emanzipierten Mann hielt, hatte sich damit längst abgefunden und erledigte also das meiste im Haushalt realiter ganz alleine, nur um den Hund machte er sich doch dann und wann Sorgen. Aber auch dieser, wohlerzogen wie er war, zeigte nie ein Zeichen des Unmutes. Auch machte das Tier keinesfalls einen ungepflegten oder gar kränklichen Eindruck. Vielmehr strotzte es nur so vor Imaginationskraft. Dies war eigentlich einer seiner herausragendsten Vorteile.
D. schritt also betont gemeinschaftlich und frohgemut in die freie Natur hinaus, betrachtete nachdenklich die vielen kleinen Regentropfen, die mit großem Eifer in die zahlreichen grauen Pfützen auf dem Feldweg hüpften, genau so, wie das D.s imaginärer Hund eben nicht tat. Nachdem D. diesem Treiben eine Weile tatenlos zugesehen hatte, beschloss er, seinen schottisch kleinkarierten Regenschirm zu öffnen, obwohl es etwas windig und D. inzwischen ohnehin schon ziemlich durchnässt war, was ihm aber nicht soviel ausmachte, da sich D. sicherlich nicht mehr würde erkälten können, denn er war es schon.
Die ihn umgebende Natur aber machte ihm doch zu schaffen. Betrüblich verharrte sie in fadem Stumpfsinn. Kahl und flach lagen die Äcker. Nur die Wegkreuze standen wie seit unerdenklichen Zeiten windschief in der Landschaft und gemahnten an das Ende aller Dinge. Nirgends war eines der putzigen Feldkaninchen zu sehen, die im Sommer doch manchmal über das Feld hoppelten, aber Sommer war es auch nicht. Und auch kein kleines weißes Wiesel zeigte sich, wie manchmal im Herbst, denn auch Herbst war es nicht. Selbst die Eichhörnchen, ansonsten zu fast jeder Jahreszeit bei den alten Eichen vorzufinden, blieben an diesem Tage wohl lieber zuhause. Somit war kein einziges Tier in der Nähe, mit dem D.s imaginärer Hund lustig hätte spielen können. Und wohl deshalb tat er das auch nicht und verhielt sich mindestens genauso passiv und lethargisch wie sein Herrchen.
D. aber kamen mit der Zeit ernstliche Zweifel, ob dies um ihn herum wirklich schon realer Frühling sein konnte. Einerseits, so meinte D. zu wissen, sei Frühling ja eine wonnevolle Jahreszeit, voller Augenblicke der Freude und vieler lustvoller Menschen, auferweckter Tiere und blühender Pflanzen. So zumindest glaubte er dies in einigen seiner vielen Bücher gelesen zu haben. Abgesehen von einigen verkrüppelten Gräslein und altersschwach dahinsiechenden Obstbäumen mit grünen Schimmelflechten war aber kein Zeichen von Leben am Ort. Andererseits, soweit sich seine geografischen und metereologischen Schulkenntnisse noch rekonstruieren ließen, war Frühling doch die Jahreszeit, in welcher die Sonnenscheinfrequenz kontinuierlich ansteige. Am grauen Himmel waren aber nur schwerfällig dahintröpfelnde Wolkenmassen auszumachen.
Vielleicht, so fragte sich D., hatte er ja einen Fehler begangen? War er vielleicht zu hoffnungsvoll gewesen, hatte sich zu sehr in die Sache hineingesteigert? Übertriebene Vorerwartungen und zuviel falscher Optimismus waren, so wusste er, die Hauptursachen von Leid in der Welt und eines der größten Übel der Menschheit. Hier konnte nur maßvolle innere Ausgeglichenheit und konzentrierte Besonnenheit helfen. D. holte tief Luft, so gut es seine verschnupften Lungen zuließen, konnte aber doch auch nichts mehr als feucht hustend wieder ausatmen. Eine innere Mitte, sollte er sie jemals besessen haben, war so nicht zu finden. Er musste, wollte eigentlich weitergehen.
Doch D. hielt stattdessen verdutzt inne und schaute etwas ratlos um sich. Sein treuer Hundegefährte war nirgends mehr zu sehen. Auch das noch, seufzte D., und machte sich betröpfelt auf den Weg nachhause, wo ihn sicher bereits seine imaginäre Freundin nicht erwartete, dafür aber umso mehr Hausarbeiten, die er sich abzubearbeiten wiederum innerlich weigerte. Hinter dem dicken grauen Wolkenschleier schwand derweil auch heimlich die treulose Sonne dahin. Obwohl die Sonnwende vorüber war und bereits das Osterfest nahte, hatte sie es äußerst eilig, sich einfach davonzumachen.
Treulos, diese ganze Welt, murrte D., aber letztlich war es ihm egal. D. schloss seine Augen, stellte sich einfach eine schöne, blendende Sommersonne vor, schritt in Gedanken an einem beblümten Abgrund entlang, ein sommerlich leichtes Bündel über der Schulter, begleitet von seinem treuen Hündlein. Er war die Null, wurde ihm in diesem Augenblick klar, der Narr.