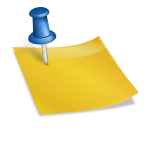D. hatte einen Freund, der sehr weit wegwohnte und von sich in Anspruch nahm, noch sehr viel mehr als D. zu arbeiten und auch sehr viel wichtigere Dinge. Deshalb fand er nur noch sehr selten den Weg zurück in die Provinz und D. schrieb ihm daher dann und wann allerlei schriftliche Benachrichtigungen, um ihn auf dem Laufenden und die Freundschaft am Leben zu erhalten. Wie es aber so war im Leben, so war D.s Freund alles andere als gesprächig und schrieb ihm nie zurück, beantwortete nicht einmal eine Zeile von D.s Korrespondenz.
Dies verärgerte D. außerordentlich, denn der ausgesprochen unkommunikative Missstand kränkte ihn sehr in seinem Gefühl für Verhältnismäßigkeit, Harmonie und Gerechtigkeit. Da er sich aber nicht an dem Freund rächen konnte, indem er dessen Korrespondenz gleichermaßen unbeantwortet ließ – denn der Freund schrieb ja niemals, beschloss D. aus Rache, die Kommunikation seinerseits abzubrechen, indem er zwar weiter getreulich Briefe an den Freund schrieb, aber keinen einzigen davon abschickte.
Auf diese doch sehr geschickte, weil vom Freund unvorhergesehene Weise milderte sich etwas der Zorn und die allgemeine Gerechtigkeit war für D. wiederhergestellt. Der Freund aber blieb stumm und ahnte nicht, welches Unglück ihn inzwischen getroffen hatte, zumindest, falls er zwischenzeitlich nicht ohnehin schon gestorben war, denn letztlich hörte D. nie wieder etwas von ihm.
Eines Tages allerdings beschloss D., einen weiteren Brief an den Freund aufzusetzen in einer dringenden Angelegenheit, die ihm schon sehr lange auf dem Herzen lag. D. war nämlich der erschreckende Gedanke gekommen, dass der Freund vielleicht inzwischen klammheimlich zu den militanten Oxford-Atheisten übergelaufen sein könnte. Diese besonders heimtückische Art von Fundamentalisten hatte sich vor einiger Zeit auf den britischen Inseln zusammengerottet, nachts auf den Kontinent übergesetzt und zuletzt die Hauptstadt Preußens für sich eingenommen, wie D. aus gut unterrichteter Quelle erfahren hatte. Von dort aus betrieben sie allerlei heimtückische Machenschaften, um auch im Rest des Landes möglichst friedliebende Menschen zu malträtieren, die noch an irgendetwas glauben wollten. Zwar hatten sie damit keinen größeren Erfolg, da die meisten Bewohner Preußens ohnehin ganz andere Sorgen hatten und sich gar nicht für eine letztlich so belanglose Sache interessieren wollten.
Der Gedanke jedoch, dass sogar sein Freund klammheimlich dieser verschwörerischen Organisation beigetreten war, schlug D., wie das unfrühlingshafte Wetter, aber dermaßen auf das Gemüt, dass er allen seinen Mut nochmals zusammennahm und folgende mahnende Worte aufsetzte:
„Lieber E.,
es gibt Dinge, die gibt es nicht, aber es gibt auch Dinge, die sollte es nicht geben.
Geben und Nehmen sind allerdings ebensowenig das gleiche wie dasselbe. Denn es gibt sicher auch Dinge, die man nehmen darf, solche aber auch, die man nicht nehmen soll. Ich nehme an, du weißt, was ich meine. Insofern nehme ich mir nach längerer Zeit nun heraus, einige mahnende Worte an dich abzugeben, welche du hiermit aber bereits schon teilweise gelesen hast.
Wäre es nämlich nicht so, wie es ist, dann müssten wir davon ausgehen, dass es anders wäre, aber keineswegs, dass es deshalb auch so sein sollte. Genau dies, der sogenannte naturalistische Fehlschluss, ist ein weitverbreiteter Irrtum, insbesondere bei solchen Leuten, die meinen, Irrtümer seien eine leichtgläubige Angelegenheit, Wissenden das Irren aber unmöglich.
Wir wissen jedoch alle, dass auch das Wissen letztlich ein Glauben ist und der Irrtum geradezu vom Wissen lebt – auch Irrtum ist Wissen – nämlich ein falsches! Falsch ist allerdings recht viel in der Welt und noch schlimmer als alles das ist die menschliche Falschheit. Falschheit ist ein innerer Zustand, der durch vieles Wissen nicht überwunden, sonders teilweise sogar noch verschlimmert wird.“
Hier stockte D., denn es wurde ihm bewusst, dass er dabei war, gegen das Allgemeinwissen anzuschreiben, was aber doch gar nicht seine Absicht war. Im Gegenteil, er war sogar überzeugt davon, dass Wissen der Grundstock einer jeden Bildung sei, eine notwendige Basis für fast alles. Das war ja auch sein Beruf. Eigentlich konnte man auch nie zuviel wissen. Also überlegte er – was war das Problem des Wissens? Eigentlich, so schloss er, lag das Problem nicht beim Wissen selbst, sondern bei der Falschheit. Was aber die Falschheit ausmachte, das war schwer in Begriffe zu bekommen. Freilich hätte er von tugendhafter Gesinnung schreiben können oder moralischem Anstand. Er hätte dabei das gesamte philosophische Wissen des Abendlandes, und falls notwendig, auch noch des Morgenlandes aufführen können.
Was aber, wenn das Gegenüber bereits so kompromitiert war, dass jegliche Geisteswissenschaft, Tugend wie Moral gleichermaßen als Täuschung oder als unbiologistische Altlast abgetan wurde? Unzweifelhaft war D. klar, dass das Wissen an sich unschuldig war, nur seine Verwendung durch verengte, methodisch vereinseitigende Ansichten verquer. Das Wissen im erweiterten Sinne jedoch, das Bemühen um die Wahrheit, war letztlich mit Aufklärung gleichbedeutend.
Also schrieb er weiter:
„Verwende das Wissen nicht falsch oder einseitig. Sei aufgeklärt!“
Hier fand D. aber, dass er dem Freunde gegenüber vielleicht doch etwas zu direkt geworden sei. Womöglich könnte der Adressat davon allzu betroffen worden sein oder das Ganze vielleicht falsch verstehen. Vielleicht wollte er aber auch gar nicht aufgeklärt sein? Zu massive Forderungen könnten ihn vielleicht auch gerade zu einer Trotzreaktion oder ganz in die falsche Richtung treiben, zumal Wahrheit als Kampfbegriff ja immer schon von allen Seiten vereinnahmt wurde. D. korrigierte also seine Aussage etwas durch sinnige Verwendung von Konjunktiv, Frageformen und einigen modalen Zusätzen:
„Wissen, dieses wertvolle Gut, wäre es nicht vielleicht kostbar genug, damit wir es für alle gleichermaßen zugänglich und verteilbar machen sollten? Dies freilich wäre schwerlich möglich, wenn es verengt getragen würde oder gar unversehens zerstört. Findest du nicht auch? Lass uns die Sache aufklären und die Welt gemeinsam verbessern!“
Hier allerdings stockte D. von Neuem – was, wenn seine Absicht auch noch an dieser Stelle falsch verstanden würde? Womöglich würde sein Gegenüber ihn nunmehr auch noch als Verbündeten sehen im sinnlosen Kampf gegen die Wahrheit und den Seelenfrieden der Menschen in Preußen. Vielleicht war es, unter diesen äußerst ungünstigen Umständen, auch das Beste, nunmehr einfach alle Karten auf den Tisch zu legen und dem Freund die Konsequenzen seines egoistischen Handelns bewusst zu machen:
„E., wir waren lange Jahre befreundet. Doch nun musst du dich entscheiden – Freunde können wir nur bleiben, wenn Frieden und Leben in Wahrheit weiter möglich bleiben. Es geht nicht anders! Entscheide dich nun, ich erwarte deine Antwort!
Hoffnungsvoll, Dein alter Freund D.“
Zwar fand D. diesen Brief sprachlich und formal und auch von der Komposition her nicht besonders geglückt, doch auch nach einigen weiteren Stunden des Nachgrübelns brachte er keine sinnigeren Formulierungen zu Stande. Also beließ er es dabei, steckte das Schreiben sorgfältig in einen Umschlag, versiegelte und adressierte ihn.
Die zuletzt eingeforderte Antwort vom Freund erhielt D. später allerdings nie, es gab nie irgendeine Reaktion.
Man sollte der Fairness halber jedoch noch erwähnen, dass auch der Freund den Brief nie erhalten hatte, da dieser, wie schon alle vorigen, von D. aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit nicht abgeschickt wurde.