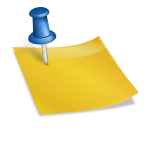Sakrale Kunst ist ungleich schwieriger umzusetzen als die profane. Dies gilt nicht nur für die abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam), von denen zumindest zwei heute daher Bilddarstellungen ganz oder größtenteils ablehnen. Aber es gilt gerade auch für diese, selbst für das heute scheinbar bilderfreundliche Christentum.
Das Christentum unterscheidet sich dabei insofern von Judentum und Islam, als es mit dem Kreuz bereits einen immanenten Ikonoklasmus enthält und sogar voraussetzt: Das einzig gültige „Bild“ des unaussprechlichen Gottes ist selbst sprachlich das durch das Kreuz gebrochene und erneuerte. In gewisser Weise ist das ein bleibender Skandal, der bis heute bei Christen wie Nichtchristen entsprechende Reaktionen hervorruft, wenn man sich dessen wahre, zeitlose Schärfe vor Augen führt.
Gleichwohl, denn Kunst neigt fast immer zu Ästhetisierung, wurde das Symbol des Kreuzes schnell entschärft, verziert, vergoldet. Heute ist es meist nur noch harmloses modisches Accessoire innerhalb der europäischen Symbolgerümpelkiste. Ein wenig ist die Entschärfung sogar schon in den Passionsgeschichten der Evangelien selbst angelegt oder in deren Ummantelung, wie z. B. in den Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas.
Das von dort vermittelte Bild der Heiligen Familie bleibt im westlichen Denken fest verankert, so fest, dass es die Säkularisierung schadlos überlebt hat und vielerorts auch gänzlich ohne religiösen Hintergrund munter weiter zelebriert wird. Heilige Familien in allerlei Ausführung erfreuen sich ungleich größerer Beliebtheit als beispielsweise das für das Christentum viel grundlegendere und bildlich noch viel weniger skandalös wirkende Pfingstfest. Krippen sind inzwischen allgegenwärtig, teilweise sogar in säkularisierter Form in diversen Soap-Operas oder Glückliche-Familien-Werbespots der Konsumwunderwerbewelt.
Und doch, der eigentliche christliche Aspekt geht selbst in traditionellen Krippendarstellungen meist völlig unter, wird zum kitschigen Wohlfühl-Event. Schaut man sich dagegen die beiden differierenden Kindheitsgeschichten bei den Evangelisten Matthäus und Lukas an, wird man das putzige Ensemble, welches heute in den Krippen herumwuselt, kaum finden. In den Originaltexten, wenn man sie mal bewusst liest, fühlt man sich eher an aktuelle Flüchtlingsschicksale erinnert – es handelt sich um Fast-Tragödien, die sich entweder im Schatten der Weltpolitik (Lukas) oder aufgrund der Willkür lokaler Machthaber (Matthäus) ereignen. Der Skandal des Gottes in Schwäche und Armut, der auch hier recht sprachbildlich in Szene gesetzt wird, wird im gängigen Krippenpomp übelst verharmlost.
Freilich, es ist schwierig, überhaupt nur das eigentliche Bild der Inkarnation des befreienden Gottes in den beiden Szenarien adäquat umzusetzen, ohne kitschig oder pompös zu werden. Bei den meisten Krippen schwingt die ständige, unterschwellige Bedrohung deshalb gar nicht mit, zudem z. B. kindermordende Herodes-Metzeltruppen den Betrachter auch ebenso abstoßen würden wie etwa ein etwas deutlicherer Hinweis auf die unterschwellige Todessymbolik der Sterndeutergeschenke. Allerdings sind die Folgen der Ästhetisierung theologisch fatal: Die Krippendarstellung verkommt zum holdseligen Puttenszenario, welches zwar dem gutsituierten Bürgertum schmeichelt, das aber der Option Gottes für die Armen überhaupt nicht gerecht wird, geschweige denn dem eigentlich spektakulären Handlungsaspekt. Ja teils wird gar die Botschaft verkehrt zu reinem „Friede, Freude, Schlummerparty“ – „Stille Nacht“ lässt grüßen. Umgekehrt würde auch eine reine Verbildlichung „göttlicher Schwäche“ innerhalb einer grausen und brutalen Realität den Anliegen der beiden Bibeltexte nicht gerecht. Denn – und hier liegt absichtlich das Paradox – gerade in scheinbarer Schwachheit wird doch die göttliche Wirkkraft vollendet (um es mal frei mit Paulus zu formulieren). Wie aber soll man das bildlich rüberbringen? Schon rein sprachlich taten sich ja die Verfasser der Bibeltexte sehr schwer!
Bildskeptiker könnten formulieren: Es geht gar nicht, aufgrund der statischen Wirkart des Mediums Bild überhaupt. Handlungsfülle, so meinte z. B. Lessing in seinem berühmten Laokoon-Fragment, könne man nur in Texten adäquat umsetzen. Umso mehr müsste dies dann noch für mehrfach in sich selbst gebrochene religiöse Texte gelten. Freilich übersieht man dabei die durchaus praktikable Mehrschichtigkeit bildlicher Darstellungen. Zwei oder mehr Aspekte lassen sich sehr wohl gleichzeitig zu Bilde bringen, selbst wenn sie in sich widersprüchlich sind – und zwar ohne sie einfach nur platt und unversöhnt geometrisch nebeneinander zu stellen. Freilich setzt bildlich-symbolische Mehrdeutigkeit dann aber wieder eine fortgeschrittene Deutungsfähigkeit beim Betrachter voraus, welche die westliche Gesellschaft, in chronischer Unterschätzung bildlicher Symbole, einfach nicht ausreichend schult. Das hat zur Folge, dass die meisten Normalbürger schon beim dechiffrieren ganz klassischer Bildmotive fast gänzlich versagen, sie mithin ebenso primitiv wörtlich nehmen wie die vielgescholtenen Fundamentalisten religiöse Texte. Da dieser kulturbanauserige Fundamentalprimitivismus keinerlei Religionszugehörigkeit voraussetzt, findet man ihn meist auch noch genau bei den Leuten, die sich für achso fortschrittlich und aufgeklärt halten. (Was gerade beim Bild mithin übrigens auch darauf zurückzuführen ist, dass die europäische Aufklärung sich allzu sehr auf lineare Texte begrenzt hat; noch schlimmer wird es nur noch, wenn man dann auch noch die Textwahrheit auf reine Binarität reduziert.)
Die Kulturblindheit beim reinen Dechiffrieren von Bildern ist freilich nur die erste Hürde, die sakrale Kunst erschwert – schließlich hat bis heute auch die Profankunst damit ihre Probleme, was ihr bisweilen fast bis an die Substanz geht, weil die Leute Kunst gar nicht mehr als solche erkennen können.
Die noch viel höhere Hürde insbesondere christlicher Kunst stellt der durchgehende theologische Ikonoklasmus bei Transzendenzerfahrungen dar. Ein Gott, der selbst in seinen Wirkungen nicht bleibend fassbar ist, sich sämtlichen menschlichen Vorstellungen und Begriffsvereinnahmungen entzieht, kann eigentlich auch bildlich nur ikonoklastisch angedeutet werden. Folglich müsste eine adäquate Sakralkunst stets zumindest teilweise ikonoklastisch-selbstentwertend sein und statt darzustellen hauptsächlich an-deuten, wäre provisorisch-interpretierend und vieldeutig unbestimmt, mithin also als solche noch viel weniger manifest als die heutige Profankunst, weil sie zwar einen Sinn voraussetzt, aber nur seine vorübergehenden Wirkungen andeutet. Jegliche Abbildung von Tat-Sachen als Inhalte verbietet sich natürlich ganz, aber auch ihre eigene Symbolik müsste sie selbstkritisch hinterfragen, ja müsste sie stets selbst neu erschaffen. Das aber ist dann doch, über rein kunsthandwerkliche Befähigung und religiöse Vorbildung hinaus, ein unzweifelbar hoher künstlerischer Anspruch.
Am leichtesten wäre dabei noch, über diverse augenzwinkernde Anleihen bei klassischen Vorbildern eine solche An-Deutung von Sinn optisch zu paraphrasieren. Allerdings kommt dabei beim Zuschauer allzuleicht nur eine reine Bildparodie an, also eher als destruktiver A-Theismus statt als konstruktive göttliche Transzendenzerfahrung. Darum habe ich bislang z. B. auch noch keine zeitgenössische Krippendarstellung gefunden, die mich nun wirklich religiös angesprochen hätte, geschweige denn, dass ich selbst eine solche Zustande gebracht hätte.