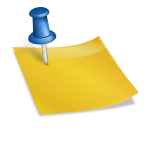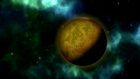Zwei Parabeln, verfasst in einer Freistunde im Jahr 1993 im damaligen Computerraum des Klettgau-Gymnasiums, heute Raum 305:
Ein Gleichnis
In A… , einer unbedeutenden Kleinstadt am südlichen Rande des Schwarzwaldes, geschah es an einem finsteren Nachmittage, als die Hitze des Tages sich gerade in ein Gewitter umzuwandeln begann, dass eine wilde Horde von Fünftklässlern einen der ihren, einen gewissen W… , in die Ecke stellte und grundlos zusammenschlug. Dieser, von der plötzlichen Härte des Lebens sichtlich überrascht, erlitt einen schweren Schock, sank nieder und blieb mit blutender Nase am Boden liegen.
Glücklicherweise ereignete sich dieser Unglücksfall in der Nähe eines häufig benutzten Fußpfades, sodass durchaus die Möglichkeit einer schnellen und zeitigen Hilfe bestand. Nach einiger Zeit kam denn auch jemand, eine gewisse C…, eine durchaus intelligente, wenn auch etwas temperamentvolle Kursstufenschülerin, daher, und, obwohl sie bis zu diesem Zeitpunkt der finstersten Depression ausgeliefert gewesen war, als sie ihn so in seinem Blute liegen sah, freute sich innigst und ging, unverrichteter Dinge und für alle Ungerechtigkeiten des Tages entschädigt, weiter.
Eine halbe Stunde später erreichte ein gewisser B…, ein bei einem großen Teil der Schülerschaft beliebter und äußerst dynamischer Lehrer, den Unglücksort, blieb gerührt, wie vom Schlage getroffen, stehen, sprach sein Beileid aus, kramte nach einem Zellulosetaschentuch, reichte es dem Verwundeten, legte es, nachdem dieser sich nicht gerührt hatte, neben ihn und verließ, da er ja noch eine Mathearbeit schreiben zu lassen hatte, den Unglücklichen.
Der blutende W…, durchaus bei Bewusstsein, blieb, obwohl er sich bereits etwas von seinen Verletzungen erholt hatte, am Boden liegen, in der naiven Hoffnung, welche den unschuldigen Geschöpfen dieses Alters noch eigentümlich ist, dass doch noch irgendwann ein barmherziger Samariter, ihm aufzuhelfen, käme.
Dieser durchaus lobenswerte Optimismus begann aber zu schwinden, als ein heftiges Gewitter loszubrechen begann, was W…, in Erinnerung seiner letzten Lungenentzündung dazu veranlasste, seinen Standpunkt aufzugeben und den Ort aus eigener Kraft zu verlassen. So erhob sich W…, durch die Ungerechtigkeit des Seins leicht ergrimmt, mit den übelsten und für dieses Alter unorthodoxen Verwünschungen auf den Lippen, machte sich auf den Heimweg und beschloss,
Atheist zu werden.
* * *
Unterwegs
Ich saß vorne auf dem Kutschbock.
Neben mir saß der Vetter. Er schien Probleme zu haben, er rieb sich unaufhörlich die Augen.
„Haben Sie Probleme?“, fragte ich ihn.
„Es ist nichts. Es ist nichts.“, erwiderte er und versuchte, sich möglichst unauffällig die Augen weiter zu reiben.
Hinter uns grölten die Fahrgäste.
Den einen fuhren wir zu langsam, den anderen war die Fahrt zu rasant. Es waren große und kleine. Einige hatten schwarze Hüte auf dem Kopf, andere trugen weiße, wieder andere rote Hemden. Einige hatten auch braune Stiefel an.
Sie konnten sich gegenseitig nicht ausstehen.
Aber die grauen Pferde vor uns trabten immer im selben Tempo gleichmäßig voran, immer in die selbe Richtung. Rückwärts laufen konnten sie nicht.
Ich schaute wieder zum Vetter: Seine Augen wurden rot; dann seine Finger, mit denen er sich schon die ganze Zeit unaufhörlich die Augen rieb.
„Sie bluten“, sagte ich.
„Es ist der Nebel; man kann kaum etwas erkennen“, meinte er.
Ich war verunsichert.
„Wohin fahren wir denn?“
Die Fahrgäste grölten.
„Weiß ich’s?“, erwiderte er.
* * *