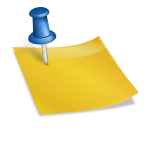Eines der wesentlichen Gegenargumente gegen die besonders einfältigen Spielarten der dawkinsschen Evolutionslehre ist, dass sich die Vielfalt und besonders die Schönheit in der Natur nicht auf ein „Survival of the fittest“ reduzieren lässt. In der Tat: Sieht man Natur nur als einen Ringkampf zwischen verschiedenen Individuen, dann ist die unglaubliche, oft unmäßige Schönheit der Wesenheiten um uns herum nichts als bloße Verschwendung.
Um die reine Theorie zu retten, könnte man noch irgendeinen erweiterten „Überlebenssinn“ zusammendichten, warum auch bloß ästhetische Gebilde wie z. B. eine Prunkrosenblüte vielleicht irgendeinen Überlebensvorteil böten oder gar zu beweisen versuchen, dass alle Blütenblätter sich auf mathematische Formeln reduzieren lassen und in einem nicht ganz zulässigen Umkehrschluss dann behaupten, dass Schönheit ein mathematisches Grundprinzip sei. Das erklärt dann allerdings immer noch nicht die ästhetische Überfülle und die faktischen individuellen Besonderheiten der Dinge in der Welt. In ihrer Existenz mathematisch notwendig sind die nämlich meist nicht und der dann oft bemühte „Zufall“ ersetzt, was in religiösen Theorien der Schöpfergott war.

Nun muss man allerdings nicht notwendigerweise zum mythischen Weltbild zurückkehren, weil die Welt eben mehr ist als nur ein Nagel, der sich mit materialistischen Theorien reduktionistisch behämmern lässt. Denn die komplexe Wirklichkeit entzieht sich einem platten materialistischen Weltbild ebenso wie einem fundamentalistisch-religiösen. Wir haben ja tatsächlich Schöpfer in der Welt, ohne die es wesentlich weniger Ästhetik auf diesem Planeten gäbe: Denn wenn ich einen wundervollen Apfel bewundere, oder die Blütenpracht der Rosen im heimischen Garten, oder die Schönheit der pastoralen Landschaften um uns herum, dann bewundere ich die Geschöpfe der kleinen Gottheit Mensch. Das alles sind nämlich menschliche Kulturprodukte. Seit sie das war, was sie zu Menschen macht, fantasievoll fühlend und denkend über die bloße Natur hinaus, gestaltet die Menschheit ihre Umwelt weltweit nach ihren eigenen Bildern von Schönheit und Sittlichkeit. Sie erschafft. Diese Schöpfung wurde zwar nicht in sieben Tagen, aber doch in den gut 6000-20.000 Jahren erschaffen, in der die menschliche Zivilisation nun schon mindestens existiert.
Das ist nun weder eine atheistische, noch eine religiöse Sichtweise: Im Unterschied zu einem sehr naiven „A-Theismus“, der Gott einfach durch das menschliche Individuum ersetzt, ein modernes, geschichtsloses und sich meist maßlos selbst überschätzendes Individuum wohlgemerkt, ist der Schöpfer unserer ästhetischen Jetztwelt kein einzelner Menschengott, sondern eine Fülle sich gegenseitig beeinflussender Zivilisationen. Das setzt eine natürliche biologische Selektion dann oft außer Kraft durch eine moralisch-ästhetische Menschheitsgeschichte, in der – wie übrigens schon Charles Darwin erkannt hat – oft ganz andere Regeln gelten.
Nicht umsonst sollen die wesentlichen Fortschritte einer Zivilisation meist unmoralische Ist-Zustände beseitigen, wozu auch gehört, dass sich nur die „Fittesten“ durchsetzen. Die größten künstlerischen, technischen, sozialen und philosophischen Fortschritte verdanken sich in aller Regel solchen Menschen, die in einem bloß biologischen System keine Chance hätten, weil sie in irgendeiner Weise „behindert“ sind. Ein perfekter Mensch z. B. bräuchte weder Brille noch Optik. Könnten Menschen von Natur aus fliegen oder Ozeane durchschwimmen, wäre einiges an Verkehrstechnik nie erfunden worden und viel dahintersteckende Physik nie durchdacht. Es sind eigentlich nie die fitten, biologisch-perfekten Menschen, welche eine Gesellschaft voranbringen, mögen sie auch noch so bewundert werden von den Massen.
Ohne die unperfekten Individuen, die oft am Sein leidend, aber einfach gegen natürliche Regelmechanismen existieren, wäre menschliche Zivilisation nie entstanden. Dies sollte man denn auch bedenken, wenn wir dann demnächst daran gehen, neues Leben nach biologischer Perfektion zu sortieren, angeblich, um „künftiges Leid“ zu verhindern. Letztlich, wenn man in offener oder verdeckter Nachfolge von Haeckel einen Sozialdarwinismus propagiert, der zu „natürlichen Zuständen“ zurückkehrt oder der Evolution etwas „nachhilft“, fällt man in einen vor-zivilisatorischen Zustand zurück.
Ich denke ohnehin nicht, dass das überhaupt praktizierbar wäre. Denn Menschen können nicht anders, sie gestalten die Welt permanent nach eigenen Vorgaben – aber unbewusst und ganz ohne einen deutbaren Masterplan. Das spricht auch gegen die Theorie von Memen, denn es gibt bei Gedanken, die wie alle metaphorischen Konstrukte keine Eindeutigkeit besitzen, keine atomaren Bestandteile, die man sequenzieren könnte. Indem Menschen sich austauschen, diffundieren ihre Botschaften in ein kaum zerteilbares und sicher nicht reduzierbares Bedeutungsgeflecht von logischen, aber auch un-logischen Gedanken, Gefühlen und nicht wirklich begrenzbaren Beziehungen. Ein „Wort“ besteht nicht aus Buchstaben, sondern vermittelt als Bedeutungsgeflecht eine kleine Welt in sich, für jeden Menschen eine andere – und ohne einen zumindest gedachten anderen Menschen als Adressat wäre jedes Wort sinnlos.
Denn Menschen werden zu Personen als Beziehungswesen, ohne ihre Beziehungen existieren sie nicht wirklich. Ihre rein materielle Körperlichkeit ist zwar Voraussetzung, umfasst aber nicht ihre eigentliche personale Wesenheit, die erst in allen ihren Bezügen entsteht. Das ist eigentlich auch die Tragik an ihrer Sterblichkeit, mit der sich die Menschen nie abfinden werden. Denn der Tod ist nicht das Ende der Materie, sondern der Abbruch der Beziehungen, der Untergang aller Korrelationen.
Dies ist eine Stelle, an der man trefflich in kybernetische, metaphysische Spekulationen übergehen könnte – denn die korrelative Wesenheit Mensch produziert in ihrer Beziehungshaftigkeit auch permanent Transzendenz, indem sie sich selbst transzendiert – was wahrscheinlich nicht mal auf menschliche Wesen beschränkt ist, sondern auf alles, was wir Menschen als intelligent ansehen. So können wir dann, ob wir es zugeben oder nicht, in der Welt auch nichts anderes erkennen als eine höhere Intelligenz, die dort mystisch am Werke ist. Und weil wir Menschen Personen sind, können wir uns diese Intelligenz letztlich auch nicht anders denken als personal, wenn wir uns mit ihr in Beziehung setzen wollen. Menschen besitzen da eine Sehnsucht, wie eine Art fest eingebaute „Antenne“. Das spricht nicht notwendigerweise dafür, dass es eine höhere Wesenheit wirklich gibt, zumal eine personale und meist ziemlich menschlich gedachte, aber es spricht auch nicht dagegen – so wenig oder soviel jedenfalls, wie sich aus dem bloßen Vorhandensein von Augen empirisch die Existenz des Lichtes beweisen ließe.
Zu kurz greifen jedenfalls die einfachen Lösungen: Auf der einen Seite steht das Konzept vom „modernen Menschen“, der sich völlig geschichtslos für den einzigen Schöpfer seiner selbst hält, verkennend, dass er jederzeit in einem grenzenlosen Beziehungsgeflecht und unabdingbar immer auch in Traditionen existiert, wozu auch notwendigerweise die Kultur der Gegenwart und der Vergangenheit gehören mit allen ihren kulturellen Eigenheiten – die „Ansichten von Gestern“ also zwangsweise inbegriffen sind.
Völlig spiegelbildlich verfehlt auch der Ansatz sein Ziel, der den gesamten Kosmos von einem zeitlosen Architekten abhängig macht, wo die Geschöpfe zu bloßen Statisten eines perfektionistischen Welttheaters werden. Und in diesem Sinne ist es dann völlig egal, ob man den Architekten „Gott“, „Evolution“, „Mathematik“ oder gar nichtssagend „Fortschritt“ nennt.
Wir würden der Welt besser gerecht werden, wenn wir einsehen würden, dass wir selbst sowohl Geschöpfe als auch Schöpfer sind, und zwar als Gemeinschaft, was eine große Verantwortung mit sich bringt, sie aber auch begrenzt. Denn unser Beziehungscharakter begrenzt unseren individuellen Einfluss, entbindet uns aber nicht von der Pflicht, für unser Handeln in unseren Möglichkeiten die moralische Verantwortung zu übernehmen. Das Konzept „Zivilisation“ ist nämlich kein Selbstläufer, der unabdingbar funktioniert – Zivilisationen können auch scheitern. In der Geschichte taten sie das schon oft – mit schwerwiegenden, ja oft tödlichen Folgen für ihre Mitglieder und ihre Umwelt.
Sie scheitern dann beispielsweise, wenn sich die Zivilisation totläuft, weil sie zu sehr nur funktionales System und zu wenig Beziehung ist. Dann opfert sie faktisch ihre Zukunft – Zukunft ist ja letztlich wiederum das Konzept, dass wir auch morgen noch Beziehungen haben werden.