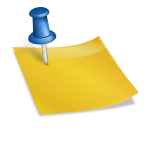Johann Georg Jacobi (*2.09.1740 – 4.1.1814), einer der Hauptvertreter der späten deutschen Empfindsamkeit, ist heute nur noch Germanisten, oder vermittelt in Vertonungen seiner Lyrik durch Reichardt, Mozart und Schubert, den Musikern bekannt. Zu seiner Zeit bedeutend war er aber auch als Aufklärer und erster evangelischer Rektor der Albert-Ludwigs-Universität im damals erzkatholischen Freiburg im Breisgau.
Frischer Wind aus Wien, oder die Freiburger Aufklärung

Freiburg war zu Johann Georg Jacobis Zeiten bei Weitem nicht so windstill und provinziell, wie man meinen könnte. Jacobis Freiburger Professur fällt in eine der geistig lebendigsten Zeiten, welche die Schwarzwaldmetropole erlebt hat. Kaiserin Maria Theresia hatte die alte Geistlichkeit der Universität bereits 1768 endgültig in die Knie gezwungen, und dank Joseph II. wehte nicht mehr nur der Höllentäler durch die Stadt, sondern eine „freimüthige“ Brise aus Wien. Der Josephinismus wirbelte 1773 selbst die Jesuiten aus der Stadt und trug neue Geister herbei, die ihrerseits energisch für Kaiser und Aufklärung Sturm bliesen.
Besonders engagiert war Johann Kaspar Ruef (1748-1825), Bibliothekar der Universität, später Rektor des akademischen Gymnasiums. Mit seiner Zeitschrift »Der Freymüthige« (1783-1787) schuf er den Freiburger Aufklärern ein literarisches Organ, das mit schonungsloser Offenheit alles anging, was sich dem Josephinismus entgegenstellte. Gesellschaftliche Breitenwirkung erzielte die Zeitschrift aber nicht, da sie sich im Laufe ihrer kurzen Geschichte immer mehr in spitzfindigen theologischen Diskussionen verzettelte. Der schroffe Ton der Zeitschrift verstimmte schließlich auch die Obrigkeit, sodass die Zeitschrift 1793 endgültig verboten wurde. Auch der Nachfolger des »Freimüthigen«, die »Freyburger Beyträge zur Beförderung des ältesten Christentum und der neuesten Philosophie« (1788-1793) [1] blieb eine theologisch-didaktische Fachzeitschrift, doch führte die Aufklärung in Freiburg zu einer einschneidenden Bildungsreform. So erhielt Freiburg schließlich eine moderne und liberale Universität sowie eine progressive Theologische Fakultät, die ihrer Zeit um mehr als hundert Jahre voraus war.
Die volksaufklärerischen Bestrebungen stießen dagegen bei einfachen Stadtbewohnern eher auf Unverständnis. Diverse Versuche, den ›Aberglauben‹ im Volk auszutreiben, führten zu massiver werdendem Widerstand. Immer wieder rotteten sich aufgebrachte Gläubige zusammen; regierungsamtliche Verbote wurden missachtet, gesperrte Wallfahrtsstätten und Kapellen eigenmächtig wieder geöffnet, verbotene Prozessionen und Pilgerfahrten in den Kommunen notfalls gewaltsam durchgesetzt. In dem Maße, wie die Regierung das Unverständnis der Bevölkerung mit noch unverständlicheren Gegenmaßnahmen und Verboten beantwortete, trieb sie das Volk geradezu in die Arme der Geistlichkeit. Denn Mönche und Kleriker waren zwar reaktionär, aber sehr volksnah.
Neben den neuen Köpfen behauptete sich in Freiburg daher auch außerhalb der Kirche weiterhin ein antiaufklärerischer Konservativismus. Die Auflösung des Jesuitenordens 1773 stellte zunächst kaum mehr als einen formalen Akt dar. Die Jesuiten wurden zwar bleibend aus der Theologischen Fakultät der Universität verdrängt, aber in der philosophischen Fakultät und am akademischen Gymnasium veränderte sich personell zunächst nichts. Dort gab es jetzt zwar keine Jesuiten mehr, dafür aber überall »Exjesuiten«, die keineswegs alle für die Aufklärung eintraten.
Einer der prominentesten Repräsentanten des Konservatismus war Heinrich Sautier (1746-1810). Er entstammte einer wohlhabenden Freiburger Familie und hatte wie sein Kollege Ignaz Felner gerade sein Lehramt am akademischen Gymnasium angetreten, als der Jesuitenorden aufgelöst wurde. Anders als Felner blies Sautier zum Gegenangriff. Bereits 1784 erschienen unter dem Pseudonym ›Erich Servati‹ seine »Freymüthigen Anmerkungen zum Freymüthigen« [2], eine scharfe und hochironische Polemik, die alle Blößen und Halbherzigkeiten der Freiburger Aufklärung geißelte. Das antiaufklärerische Pamphlet wurde weit über Freiburg hinaus bekannt. Als Sautiers Autorschaft feststand, folgte eine regelrechte Literaturfehde zwischen ihm und den Aufklärern, die bis 1791 andauerte.
In diese bewegte Zeit fällt Jacobis Wirken in Freiburg. Dass Johann Georg Jacobi heute meist als unpolitischer Schöngeist gilt, muss unter diesem Aspekt relativiert werden. Verglichen mit den radikalen Aufklärern oder den späteren Liberalen wie seinem Schüler Karl von Rotteck (1775-1840), hielt sich Jacobi sicherlich politisch zurück, aber als Protestant im katholischen Freiburg war er schon an sich ein Stein des Anstoßes. Hinzu kam, dass er mit seinem ästhetischen Programm auf seine Weise den Josephinismus vorantrieb. Nicht wenige Frauen besuchten seine Vorlesungen und lasen seine ästhetischen Schriften, statt wie ehedem, Betstunden und Rosenkränze abzuhalten. So war Jacobi allen den Geistlichen ein Dorn im Auge, die gerade auf diese Gläubigen bauten und nun ihren Einfluss auf die weiblichen Kirchenbesucher zunehmend schwinden sahen. Sautier war wohl nicht der einzige, der seinem Ärger darüber öffentlich Luft machte [3].
Die Wallfahrt nach Compostell
Als Jacobi im Jahr 1791 sein Theaterstück »Wallfahrt nach Compostell« aufführen ließ, hatte bereits eine Kehrtwende eingesetzt. Nach dem Tod von Joseph II. war man in Wien sehr schnell wieder auf alte Bahnen eingeschwenkt. Die Revolution in Frankreich und die Widerstände der eigenen Bevölkerung gegen die Zwangsreformen wurden miteinander gleichgesetzt. Aus Furcht vor allem Neuen bemühte sich die Regierung, das Rad wieder zurückzudrehen. Damit verloren die Freiburger Aufklärer unversehens ihre Rückendeckung aus Wien. Mit dem äußeren Druck durch die französischen Revolutionsarmeen wurde auch die innere Reaktion immer stärker.
Unter politischen Druck geriet auch der frankophile Protestant Jacobi, obwohl ihn der Senat 1791 demonstrativ zum Rektor der Universität gewählt hatte. Schließlich bedurfte es nur noch eines kleinen Anlasses, um dem Unmut öffentlich Luft zu machen, und dieser Anlass war Jacobis Einakter.
Zur Handlung
Clärchen, die Tochter des Dorfwirtes Jacob und der Frömmlerin Gertrud, hatte sich in den jungen Dragoner Carl verliebt und ihn heimlich geküsst. Ein Blitz, der gleichzeitig in einen nahen Baum einschlug, wurde von ihr, ihrer Mutter und dem einfältigen Waldbruder Martin als Zeichen göttlichen Zornes gedeutet, das auch Buße verlange. Gegen den Willen des Vaters brach Clärchen in Begleitung des Waldbruders zur Pilgerreise auf.
Das Stück setzt zu der Zeit ein, als man die beiden Pilger zurückerwartet, und zwar mit einer handgreiflichen Eheszene: Jacob und Gertrud machen sich gegenseitig gröbste Vorwürfe wegen der Pilgerreise ihrer Tochter. Als der Streit am heftigsten ist, tritt Carl ein, um seinen Leutnant, den spöttischen Flitterbach, anzumelden. Alleingelassen hecken Jacob und Carl einen Plan aus, um Clärchen von ihrer »Andächteley« zu heilen: Noch im Pilgerkleid soll Clärchen aus eigenen Stücken Carl nochmals küssen, sodass ihre Wallfahrt ungültig wird.
Kaum ist dieser Plan gefasst, kommt auch schon Leutnant Flitterbach und meldet die beiden Pilger. Kurz darauf erscheint der Waldbruder Martin, um Jacob für seine Tochter um Verzeihung zu bitten, weil das Mädchen selbst aus Furcht zurückgeblieben ist, um die väterliche Vergebung abzuwarten. Carl macht sich sofort auf den Weg zu Clärchen. Inzwischen neckt Flitterbach den Waldbruder, indem er ihm Carls Plan verrät. Der Waldbruder bürgt für Clärchens Standhaftigkeit. Darauf beschließt man Clärchen und Carl heimlich im Gebüsch aufzulauern, um in Erfahrung zu bringen, ob die Pilgerin standhaft bleibt, oder ob ihre Gefühle für Carl stärker sind.
In der Zwischenzeit sind Carl und Clärchen zusammengetroffen. Clärchen leistet anfangs großen Widerstand, durch Carls (teils gespielte) Liebesklage wird sie aber mitleidig, schließlich leidenschaftlich. Carl erhält zuletzt den erwünschten Kuss, woraufhin Leutnant Flitterbach aus dem Gebüsch laut applaudiert. Er und die anderen kommen nun aus ihrem Versteck hervor: Vater Jacob versöhnt sich mit Clärchen und seiner Frau. Abschließend wird ein Heiratstermin vereinbart, und alle sind glücklich und zufrieden – selbst Bruder Martin, der angesichts dieser Wendung eingesteht, dass man sich Wallfahrt hätte sparen können.
Freiburger Reaktionen
So harmlos das Stück dem heutigen Leser erscheint, so groß war die Empörung bei den Zeitgenossen. Von der negativen Resonanz erfahren wir durch einen Artikel aus den »Freyburger Beyträgen«. Dort verteidigt Ruef, wohl in Absprache mit Jacobi, das Theaterstück. Er weist darin Vorwürfe gegen das Stück zurück, und legt die wahren Intentionen des Autors dar. Die Kritik gleich nach der ersten Aufführung lautete nach Ruef: »Ein Protestant habe die katholische Religion angetastet, und lächerlich zu machen gesuchet« (Beyträge, S. 150). Auf Ablehnung stieß vor allem die implizite Kritik am Wallfahrtswesen. Auch der einfältige Waldbruder Martin wurde als Spott auf das Ordenswesen verstanden. Die Reaktionen waren heftig. Ein nicht näher genannter General drohte sogar damit, Jacobi und die Doblersche Schauspielertruppe in Wien anzuzeigen, falls das Stück nochmals aufgeführt werde. Auch die Freiburger Zensur nahm sich des Stückes an, konnte daran aber nichts Anstößiges finden, und gab es daher wieder frei. Über eine weitere Aufführung ist aber nichts bekannt.
So ganz unverständlich ist die zeitgenössische Reaktion auf Jacobis »Wallfahrt« nicht. Tatsächlich vertritt das Stück eine protestantisch-aufklärerische Position, die bürgerliche Tugenden wie Gehorsam gegen Familie und Staat deutlich über die Religion setzt. Jacobi stellt Clärchens Vater Jacob dem Heiligen Jacob von Compostella gegenüber: Clärchen handelt falsch und unvernünftig, weil sie sich gegen ihren leiblichen Vater und für den Heiligen im fernen Compostella entscheidet. Ihre Reise ist überhaupt von vornherein unnütz, ihr Motiv abergläubisch. Seiner Frau Gertrud sagt Jacob, statt in der Kirche zu beten, solle man lieber fleißig arbeiten; religiöser Eifer nütze nichts, wenn er durch Zänkerei und Geiz im Alltag entwertet werde. Darin folgt das Stück Gellerts Erziehungskonzept für das »rührende Lustspiel«. Parallelen zu Gellerts »Die Bethschwester« (1745) sind nicht zu übersehen. Gleichzeitig liegt Jacobi damit auf der Linie des Josephinismus: Religiosität darf dem Wohl der Gemeinschaft nicht entgegenstehen, vielmehr muss sie auf ihre Nützlichkeit überprüft werden.
Über bloße Aufklärung schießt das Lustspiel jedoch hinaus, wenn Jacobi seinen Waldbruder »Martin« nennt und damit auf Martin Gerbert, den prominenten Abt vom Schwarzwald anspielt. Auch dass ausgerechnet ein Blitzschlag die Wallfahrt auslöst, ist brisant. Gerade das Verbot des Wetterleutens gegen Blitzschläge hatte schon 1783 im Breisgau zu Aufruhr geführt.
Die Vertreter der Tradition bedachten das Lustspiel mit demselben Verdikt der Einfalt, mit dem auch Ruef seine Gegner abkanzelte. Mit der Gegenüberstellung zwischen ‚vernünftig‘ und ‚fromm‘ schlägt Jacobi einen allzu bekannten Ton an. Denn diese Argumentationsstruktur findet sich überall in den Diskursen der Freiburger Aufklärer. Wie Gertrud gleich zu Anfang handgreiflich zu ihrem Milchlöffel greift, so widersetzte sich auch die traditionsverbundene Bevölkerung Vernunftansprüchen und Obrigkeit.
Die Zeitgenossen konnten Jacobis Lustspiel leicht als Parodie auf die Freiburger Zustände deuten. Er spricht sich darin gegen abergläubische Frömmelei und für die Vernunft aus. In einer protestantischen Stadt hätte das kleine Stück niemanden erregt. In Freiburg aber, zumal nach dem Tod Josephs II. und unter dem Druck der Reaktion, war es ein deutliches, lokalpolitisches Zeichen.
Jacobis Zentralfigur, der Vater Jacob, zeigt sich nicht nur als aufgeklärter Christ, sondern auch als tolerantes Familienoberhaupt. Jacob kritisiert zwar die Frömmelei von Frau und Tochter, verbietet sie jedoch nicht, sondern versucht die religiöse Praxis der beiden zu mäßigen. Er hegt weder gegen die örtliche Kirche, noch gegen den Heiligen Jacob von Compostella persönlichen Groll. Jacob ist kein radikaler Umstürzler, kein Atheist, kein Spötter wie der Leutnant Flitterbach. Er trägt seinen »Widersachern« nichts nach: Am Schluss kann sich Waldbruder Martin einer freundlichen Einladung zur Hochzeit ebenso gewiss sein, wie Leutnant Flitterbach.
Ziel ist also ein maßvolles Miteinander, das andere Meinungen kritisiert, ohne sie zu verbieten. Jacobis Stück propagiert keine Abschaffung der Traditionen, sondern eine milde Aufklärung, die religiösen Brauch auf ein vernünftiges Maß zurückführt. Nicht umsonst pflegte Jacobi Kontakt zu Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774-1860), dem beispielhaften Vertreter maßvoller sozialer Reformen. Mit einem Mann wie Wessenberg konnte in der Sozialarbeit selbst Heinrich Sautier leben – und wenn auch Wessenberg nicht alle seine Reformpläne umsetzen konnte, so erreichte er doch wesentlich mehr als die allzu radikalen Reformer vor ihm.
(Zuerst veröffentlicht in gekürzter Form als Beitrag in: Aurnhammer, Achim / C. J. Andreas Klein (Hgg.): Johann Georg Jacobi in Freiburg und sein oberrheinischer Dichterkreis 1784–1814, Ausstellungskatalog, Freiburg i. Br. 2001, S. 19-22.)
Literatur
[1] Freyburger Beyträge zur Beförderung des ältesten Christentums und der neuesten Philosophie.
[2] Servati, Erich, Freymüthige Anmerkungen zum Freymüthigen, Eine Freyburger Monatsschrift, Freiburg 1784.
[3] Vgl. Servatis Satire „Die Kunstrichter“, in seinem Band „Ländlicher Briefwechsel der vorderösterreichischen Kirchenreformatoren unter dem Namen des Freymüthigen. Zweites Päckchen“, Freiburg, 1785, Bd. 1, S. 52. Sautier führt Jacobi hier als „Säugling“, und greift damit die Satire Nikolais wieder auf. Friedrich Nikolai hatte Jacobi unter diesem Namen schon in seinem Sebaldus Nothanker verspottet.