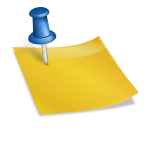Eine Sache ist meiner Ansicht nach gut gemacht, wenn sie gut gemacht ist; wenn sie passt. Übermäßige Perfektion ist genauso schädlich wie mutwillige Schlampigkeit.
Tendenziell tendiere ich eher zum Perfektionismus als zur Schlampigkeit, weshalb ich mit Kommentaren von früheren Arbeitskollegen, ich solle eine Arbeit im Zweifelsfall doch einfach irgendwie durchhuddeln auch nie viel anfangen konnte. Meine Antwort war dann immer: Ich mache eine Sache entweder richtig, oder gar nicht. Dazwischen gibt es nichts. Denn mutwillig herumzuschlampern ist für mich nicht viel mehr als eine sündhafte Verschwendung von Lebenszeit.
Die Perfektionierungsfalle
Umgekehrt führt nach meiner Erfahrung allerdings auch Perfektionismus zu Unheil. Jenseits der 100%-Linie wartet nämlich nicht das Paradies, sondern die Perfektionierungsfalle. Die meisten Perfektionisten scheitern ja schon weit vorher, weil sie die absolute Perfektion ohnehin nicht erreichen und daran schlichtweg verzweifeln. Aber auch die wenigen, die ihr Ziel erreichen, wirklich vollkommene Werke zu erschaffen, erwartet nicht der Himmel, sondern die Hölle, die sie sich damit selbst geschaffen haben:
Denn bei ihnen selbst erzeugt die erreichte Perfektion letztlich nur das nagende Gefühl, den eigenen Zenit überschritten zu haben und ein dumpfes Gefühl von Sinnlosigkeit. Das ist die postnatale Depression des Meisters. Sie kann, so glauben viele, nur durch weiter gesteigerten Eifer kompensiert werden. Noch schlimmer aber ist die Erwartungshaltung der Umwelt, das Publikum setzt natürlich bei jedem neuen Meilenstein die Latte etwas höher. Wer würde denn schon ein Bild kaufen, wenn das frühere schöner war, oder eine Software, wenn der Vorgänger besser war, oder ein Auto, wenn das Vormodell einfach robuster und tauglicher war? Wer möchte eine Veranstaltung loben, wenn der Meister früher größere und bessere gestaltete?
Natürlich erwartet man immer, dass es besser wird. Der Aufwand, bei einem ohnehin schon guten Produkt eine bemerkenswerte Verbesserung zu erzielen, wächst aber exponentiell mit der schon zuvor erreichten Qualität. Wenn zum Beispiel ein Computernetzwerk zu fast 100% funktioniert, sind die Kunden nach meiner Erfahrung mit dem Administrator nicht etwa zufrieden, sondern erwarten eben noch mehr Netzwerk, zusätzliche Computer, Multimediastationen oder haben irgendwelche Sonderwünsche, die zunehmend verwegener und auch immer teurer werden. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der das in alle Ewigkeit gut überstanden hätte, denn nach oben hin wird die Luft immer dünner und die Anzahl möglicher Helfer bei zunehmender Perfektion auch immer geringer; die Dankbarkeit und Geduld der Kunden übrigens ebenso. Das gilt auch in fast allen anderen (er)schaffenden Arbeitsbereichen (z. B. auch Theater, Musik, Publizistik, Pädagogik), weil wir auch da ja zunehmend industriell denken und das erzeugt einen Leistungsdruck, an dem viele Menschen, oft auch schon Kinder, scheitern, denn alles muss immer schneller und immer besser gehen. Das kann nicht funktionieren, weil Menschen eben doch keine Maschinen sind, sondern Organismen.
Geplante Obsoleszenz
Gleichwohl hält natürlich auch die moderne Ökonomie eine Lösung bereit. Die angebliche Antwort der Industriegesellschaft auf die Perfektionierungsfalle lautet: geplante Obsoleszenz. Das schöne Wort täuscht darüber hinweg, dass es sich im Klartext um nichts anderes handelt als um eine Schlampigkeit, die absichtlich so eingebaut ist, dass sie dem Käufer nicht gleich auffällt, später aber schon, weshalb er dann in jedem Fall ein neues Produkt kaufen muss. Das ist sogar noch schlimmer als ungeplante dümmliche Schlampigkeit, denn da hier auch noch eine Täuschungsabsicht vorliegt, erfüllt das eigentlich den moraltheologischen Sachverhalt der Lüge. Will man allerdings einen Markt für ein Produkt möglichst lange offen halten, führt nach den Glaubenslehren einiger Ökonomen bislang an Obsoleszenz kein Weg vorbei; und mal ehrlich, mit der Wahrheit nimmt es die Konsumgesellschaft ohnehin doch nicht so genau…
Trotzdem sollte man das Mantra geplanter Obsoleszenz tunlichst aus seiner eigenen Biografie heraushalten, will man nicht selbst zum Konsumzombie verkommen. Aufgabe eines kritischen Konsumenten muss doch darin bestehen, vorab souverän zu prüfen, was er sich vielleicht anschafft. Das ist die Gegenseite zur wundervollen Welt der Werbung, die versucht, den Konsumenten mit Illusionen rumzukriegen.
Auf den Rahmen kommt es an
In einer Bildungsdemokratie, zumindest in einer, die diesen Namen verdient, bleibt Obsoleszenz daher nur eine Scheinlösung für die Perfektionierungsfalle. Das eigentliche Problem besteht ja nicht in der Vollkommenheit eines Produktes, sondern in der irrigen Meinung, man müsse Kunstwerke oder auch Lebenswerke industriell endlos in Serie produzieren.
Perfektion bedeutet nämlich nicht bloß, dass eine Sache keine Fehler enthält, sondern auch, dass die Sache eben wirklich stimmig passt, z. B. zur Person, die sie braucht. Daher ist eigentlich augenscheinlich, dass, solange dieser Gebrauch stimmig funktioniert, eigentlich auch nichts Neues nötig ist. Denn wahre Schönheit altert nicht und Dinge, die bloß hübsch sind, nicht aber auch einen Nutzen haben, verdienen nicht das Prädikat „schön“. Nicht umsonst gelten die Werke der Shaker als zeitlos schön, welche lange vor dem Bauhaus die Philosophie der Einheit von Schönheit und Gebrauch in ihren Gebäuden und Möbeln zelebrierten – ihre Arbeit sollte ihren Glauben an den Schöpfergott materialisieren, tatsächlich würden sie noch heute Design- und Verbraucherschutzpreise gewinnen, wenn es die Shaker-Künstler noch gäbe, was aber nicht mehr der Fall ist. Auch daran erkennt man Vollkommenes, dass es seine Schöpfer überlebt.
Im Alltag einer säkularen Welt sollte man die Messlatte allerdings niedriger ansetzen, dennoch bleibt Arbeit nur dann sinnerfüllt, wenn sie sich feste Grenzen setzt, die sie ausfüllen kann. Grenzenlos tätig zu sein mit Vollkommenheitszwang führt in die absolute Erschöpfung, grenzenlose Schlampigkeit auf Umwegen aber ebenso. Es ist in beiden Fällen die Grenzenlosigkeit, die verödet. Gute Arbeit, die ihren Rahmen voll und ganz erfüllt, bleibt das beste aller möglichen Ziele – und hat man eines erreicht, sollte man doch auch weiterziehen dürfen, um anderorts einen neuen Rahmen zu füllen.
Gleichwohl steht jedes Werk für sich und was am einen Ort ein großflächiges Wandgemälde ist, kann am anderen auch nur ein briefmarkengroßes Miniaturbildchen sein. Vollkommenheit ist keine Frage der Größe und Lautstärke, sondern eine der Sinnerfüllung. Und zum menschlichen Leben gehört auch dazu, dass wir Sisyphos gleich den Stein immer wieder neu herauf rollen müssen – oder in Fußballersprache formuliert: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ – Dennoch gibt’s im Fußball Regeln, an die man sich halten muss und ein gutes Spiel ist allemal besser als ein schlampiges, selbst dann, wenn es am Ende verloren geht.