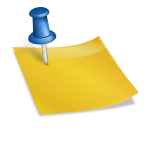In den vergangenen fünfzehn Jahren habe ich 4540 E-Mails geschrieben, davon die meisten dienstlich, doch mindestens ein Drittel auch privat, wahrscheinlich waren es sogar noch viel mehr, weil dabei die Online-Webmailer gar nicht mal mitgerechnet sind. Hinzu kommen noch Chateinträge aus den Chatprogrammen vergangener Tage, die gedruckt mehrere dicke Bände füllen würden, auch wenn diese sprachlich schlecht zu lesen wären.

Wenn ich derzeit mancher Tage das Gefühl habe, das Leben zog an mir vorbei wie ein dröhnender Karnevalsumzug von Fremden, sind es diese digitalen Lebenskommunikationsreste, die mich eines Besseren belehren. Da war manchmal doch etwas. Bloß: Ich kann mit den erstaunlich vielen pseudonymen Nicknames oft nicht mehr viel anfangen und selbst bei den stilistisch fachlich zurecht geschneiderten Digitalbriefen bin ich zwar erstaunt über die vielen Korrespondenzen mit einstigen Kommilitonen und Studienpartnern, geblieben ist davon jedoch letztlich nichts, außer die Mails eben, die erstaunlich detaillierte Ausschnitte aus dem Denken und Leben von Mitmenschen und dem Ich vergangener Tage liefern. Manchmal waren sie sogar recht innig. Tiefgang, den ich heute vermisse.
Und wenn ich die Briefe mit dem „wahren Leben“ vergleiche, wie es lief, wie es sich entwickelt hat, stelle ich doch oft eigenartige Differenzen fest, die sich langsam zur Vergangenheit herausgebildet haben, ebenso wie manch einer meiner Tagebucheinträge mit der offiziell rekonstruierten Vergangenheit nichts zu tun hat – obwohl beides Originale sind und näher dran am damals als die Gedankenkonstruktionen der Gegenwartsgesellschaft. Das erzeugte bei mir in den vergangenen fünf Jahren zunehmend das Gefühl, im falschen Film zu sitzen. Doch es half nichts, die Figuren der Vergangenheit zerstoben und zerstieben wie Seifenblasen. Man liest – man sieht, man versuchte jenes und dieses – und rührt doch letztendlich bloß noch in Seifenlauge herum. Wenn man darüber nachgrübelt und einen Mechanismus darin zu erkennen sucht, oder gar so etwas wie Mitschuld, warum diese oder jene Beziehung schieflief oder in der Wüste des Vergessenwerdens versandete, wird man auch nicht klüger, man macht sich nur verrückt.
Wahrscheinlich wäre es sowieso das Beste, die gesamte veraltete Korrespondenz in einem schönen, warmen, virtuellen Autodafé-Feuerlein zu vernichten, wenn sie nicht eben doch auch soviel biografische Wahrheit enthalten würde, die Teil der eigenen Persönlichkeit ist und die man auch in der Gegenwart bisweilen dringend brauchen kann, und sei es nur, um für sich selbst im Zweifelsfall nachzuweisen, dass man sich sein gesamtes bisheriges Leben nicht einfach nur eingebildet hat.