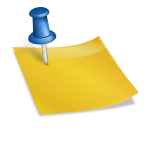Ich saß vorne neben dem Vetter. Vor uns trabten die Pferde. Ich sah zum Vetter. Er schien Probleme zu haben. Er rieb sich unaufhörlich die Augen.
„Haben Sie Probleme?“, fragte ich ihn. „Es ist nichts, es ist nichts“, antwortete er und versuchte, sich möglichst unauffällig weiter die Augen zu reiben. Hinter uns grölten die Fahrgäste: Den einen fuhren wir zu langsam, den anderen war die Fahrt zu rasant. Es waren große und kleine. Einige hatten schwarze Hüte auf dem Kopf, andere trugen weiße, wieder andere rote Hemden. Manch einer hatte auch braune Stiefel an. Doch es waren auch Flüchtlinge unter ihnen. Sie alle konnten sich gegenseitig nicht ausstehen.
Aber die grauen Schimmel vor uns trabten unbehelligt weiter immer gleichmäßig voran, fast schon notgedrungen, immer mit der gleichen Geschwindigkeit, immer weiter in die gleiche Richtung. Rückwärtslaufen konnten sie nicht. Es gab kein Zurück.
Ich blickte wieder zum Vetter. Seine Augen wurden rot, dann seine Hände, mit denen er sich schon die ganze Zeit unaufhörlich die Augen rieb. Ich dachte an verschiedene Zahlen, die mir am Vortag genannt worden waren. Alle beängstigend. „Sie bluten“, wandte ich mich ihm zu.
„Es ist dieser vermaledeite Nebel; man kann doch kaum etwas erkennen!“, stöhnte er. Ich war verunsichert. „Wohin fahren wir denn eigentlich?“, wollte ich wissen.
„Weiß ich’s?“