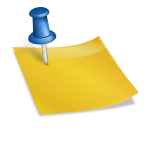Soziale Netzwerke wurden vor etwa 10 Jahren als das lang ersehnte technische Mittel angepriesen, eine direktere Demokratie zu ermöglichen. Hier, so die Hoffnung, bestünde die Chance, politische Prozesse auf breiterer Basis zu diskutieren, ein volksnäheres Element einzuführen, das von den meisten Nutzern zunächst allerdings eher zum spielerischen Zeitvertreib und zur Selbstdarstellung gebraucht wurde. Das ändert sich nun. Ob dies allerdings nützen wird, ist fraglich. Es hat mehr etwas von Trollwiesenschlägereien und persönlicher Rechthaberei als von sozialer Teilhabe.
Der gewöhnliche Facebook-Nutzer nutzte das „soziale“ Netzwerk in seinen ersten Jahren eher für allerlei Onlinespielchen. Mit Massenspielereien wie der „Farmville“-Welle wurde das Netzwerk groß, daneben konnektierte man sich lustig mit allen möglichen Leuten, die, obwohl man sie oft nicht kannte, zu seinen täglichen „Freunden“ wurden, denen manche ihr Privatleben oft geradezu voyeuristisch ausbreiteten. Man gründete Gruppen für allerlei Facetten einer besseren Wellness-Welt. Andere nutzten die Netzwerke für Reklame und Selbstdarstellung, mit vereinzelten Lichtblicken von lokaler Kleinstkultur und poetischen Anwandlungen in Form von Sinnsprüchen, Blümchen und Katzenbildern.
Spätestens seit der „Flüchtlingskrise“ wandelt sich dieses Bild. Mehr und mehr werden soziale Netzwerke zum Tummelplatz ideologischer Kämpfe und die schonungslose Verwischung von Privatsphäre mit Öffentlichkeit fordert nun ihren Tribut. Da werden maßlos ideologische Grundsätze bis in das letzte Provinzwohnzimmer hinein durchgesetzt, eine Einheitskultur gepredigt, von der frühere Diktaturen nur träumen konnten, es gibt nur da nur noch wahr und falsch und dazwischen wird erbittert um den Wahrheitsgehalt der eigenen Meinung gestritten. Nie war Ironie so unerwünscht, nie hat man sich so heftig über die Tagespolitik gefetzt, nie war man mit soviel Gefühl dabei. Nur, – die meisten Nutzer haben sich damals nicht deshalb einen Account in einem „sozialen“ Netzwerk zugelegt, um sich abends nach getaner Arbeit noch mit anderen, meist unbekannten Nutzern zu zoffen und dann zutiefst betroffen nachts wach zu liegen im Bewusstsein, dass die Welt immer böser und schlechter wird – sondern die tägliche Ration Onlinechat war eigentlich eher dazu da, um sich zu zerstreuen. Daher denke ich, dass diese Entwicklung – frei nach dem Motto: „Töte den Boten!“ – letztlich schon sehr bald auf die sozialen Netzwerke selbst zurückfällt. Aus Sicht der Politik und der Ordnungsinstanzen sind sie Horte von Demagogen, Trollen oder unkalkulierbarer extremistischer Verschwörer, die man nun endlich schleunigst reglementieren sollte – und Rufe nach Kontrolle und Überwachung werden immer lauter.
Aus Sicht der Nutzer, der eigentlichen Basis aller Netzwerke – und das ist letztlich viel fataler – machen sie so einfach keinen Spaß mehr. Denn für die meisten Nutzer waren soziale Netzwerke nie ein Mittel zur Durchsetzung von direkter Demokratie, sie wollten sich einfach möglichst mühelos und mit möglichst wenig zusätzlichen Verantwortlichkeiten mit anderen Menschen austauschen. Die viele Mühe, die man nun täglich aufwendet, um hobbymäßig die jeweils eigene politische Gesinnung zu begründen und gegenüber seinen vielen „Freunden“ durchzusetzen, sie wird mehr und mehr in Verdruss umschlagen, und das kostet aktive Benutzer. Denn zerstreuen kann man sich inzwischen anderweitig besser, und über Politik diskutiert sich offline besser als in einem Onlinepranger, wo jedes Wort jederzeit so ohne personale Verbindlichkeiten gegen den Urheber verwendet werden kann, wenn es einem nicht in den eigenen Kram passt.
Für den, der direkte Demokratie anstrebt, ist dieser Zustand ebenso unerträglich, denn Demokratie lebt von einem offenen Diskursprozess und aus den sozial verbindlichen Kompromissen, die in einer aufrichtig und verantwortlich geführten Diskussion gewonnen werden, jedenfalls aber nicht von der jeweils lautesten Meinung des Online-Mobs, der heute so, und morgen schon ganz anders fühlt, statt erörtert oder wenigstens über Sachverhalte nachsinnt.