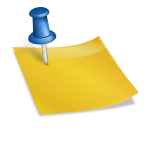In meiner Wohnung, in meinem Arbeitszimmer, hängt die Wahrscheinlichkeitsuhr. Sie ist ein seltsames Konstrukt, das meine wenigen Besucher in der Regel verwundert, aber nur eine von vielen wahr gewordenen Metaphern, mit denen sie bei mir nichts anfangen können.
Die Wahrscheinlichkeitsuhr ist eigentlich kein großes Ding: Eigentlich verhält es sich mit der Wahrscheinlichkeitsuhr ganz einfach: Es ist eine Papptafel zur Anzeige von Modalität, die ich einst im Referendariat für den Deutschunterricht in der 8c erstellt hatte. Der einzige Zeiger auf dieser Uhr lässt sich so einstellen, dass man damit für einen beliebigen Satz die vermutete modale Wahrscheinlichkeit darstellen kann. Die Schritte reichen von „sicher“, bis „unmöglich“. Seit aber nunmehr 16 Jahren verharrt die Uhr in magisch-symbolischer Bedeutung, ihr Zeiger steht seither auf „unmöglich“ – und wahrscheinlich ist es genau das, was meine Besucher in der Regel so an ihr stört.
Dabei ist diese Anzeige eigentlich ein positives Postulat: Der Zeiger wurde von mir in einer tiefen persönlichen Sinnkrise im Winter 2002 auf diese Position verrückt, in der Prüfungsphase meines Referendariats, in der mein Leben spitz auf Kante stand und ich nahe dran war, alles hinzuschmeißen. Eigentlich ist die Botschaft, welche diese Uhr seither vermittelt: „Du schaffst es schon, scheinbar unmögliches kann und wird Wirklichkeit werden!“ – und ich habe den magischen Zeiger auf dieser Position belassen, weil ich immer der Meinung bin, dass lebendige Menschen eigentlich immer unmögliches wahr machen können, wenn sie nur wollen. Das ist eigentlich meine Definition von Lebendigkeit.
Ich muss allerdings zugeben, dass meinen Besuchern der letzten 16 Jahre diese Dimension der magischen Wanduhr verborgen geblieben ist. Sie sahen die Uhr, ärgerten sich über meinen vorgeblichen Pessimismus und fragten auch nie nach. Und wenn man nicht nachfragt bei mir, bekommt man über Symbole auch keine Auskunft.
Ich gebe auch zu, dass diese Uhr in meinem Arbeitszimmer nicht isoliert hängt, denn das größte Bild in meinem Arbeitszimmer ist „Refugium“ von Hans-Werner Sahm. Der Kunstdruck bildet eine Stadt ab auf dem Grat eine Wasserfalls, der tosend in den Abgrund stürzt – für mich auch eine symbolische Aussage, wandeln wir doch stets auf einem schmalen Grat zwischen Höhen und tiefem Fall, eine biografische Ausgesetztheit, die eigentlich die sinnhaften Tiefen unserer Lebenslandschaft aushandelt. Doch für solche symbolische Tiefenreflexionen lassen die ungeordneten Bücherstapel überall in meinem Arbeitszimmer den Besucheraugen gar keinen Platz.
Und ich muss zum Dritten zugeben, dass die Verkettung all der insgesamt recht unwahrscheinlichen Unglücksfälle, die sich in den letzten sieben Jahren in meinem privaten Leben ereigneten, mich hat zweifeln lassen, ob es wirklich klug war, den Zeiger der Wahrscheinlichkeitsuhr damals auf „unmöglich“ zu belassen. Eigentlich ist ja nicht alles, was unmöglich ist, auch gut. Eigentlich hätte ich ihn schon längst umstellen können, denn außer dem recht langweiligen „sicher“ gibt es für die Wahrscheinlichkeitsuhr ja auch andere hübsche Positionen, wie z. B. „wahrscheinlich“ oder „möglich“, die eigentlich viel neutraler sind. Doch mir war die mittelmäßige Realität nie genug, genauso wenig das Erreichte, und mit weniger als dem Unmöglichen gab ich mich eigentlich nie zufrieden im sonst eher banal-betrüblichen Leben in Lauchringen.
„Eigentlich“ ist ein höchst diffiziles Wort. Es drückt aus, dass etwas möglich oder geradezu erwartbar wäre, dass es sich aber doch nicht so verhält. Es ist etwas Nicht-Real-Gewordenes und je nach Geschick des eigenen Lebens ist der Wert der Eigentlichkeit höher oder niedriger. Ob ein Sinken oder Fallen des Pegels positiv zu bewerten ist, hängt von der Sichtweise ab. Denn ein Leben könnte oft eigentlich besser oder eigentlich schlechter ausgefallen sein. Trotzdem, ein Leben, dass nur eigentlich glücklich war ist meiner Meinung nach genauso so schlimm wie eines, das sich nur im Konjunktiv II ereignet, also eigentlich gar nicht.